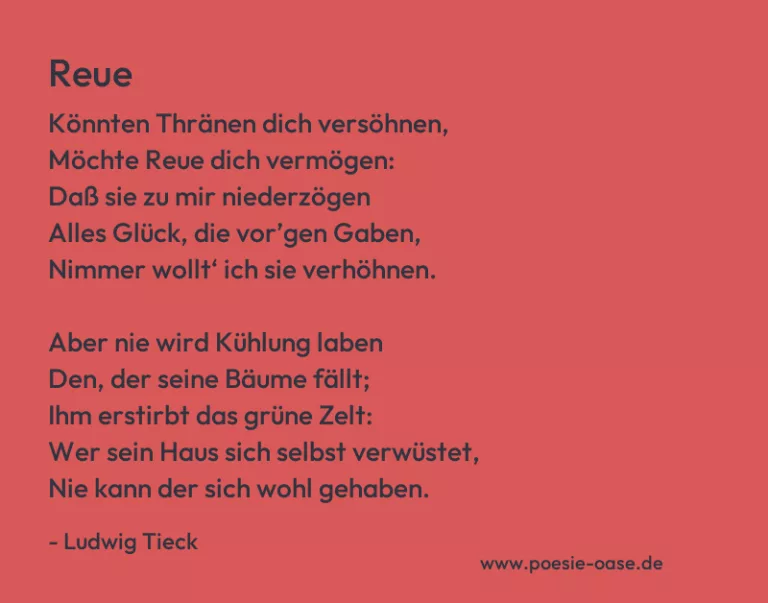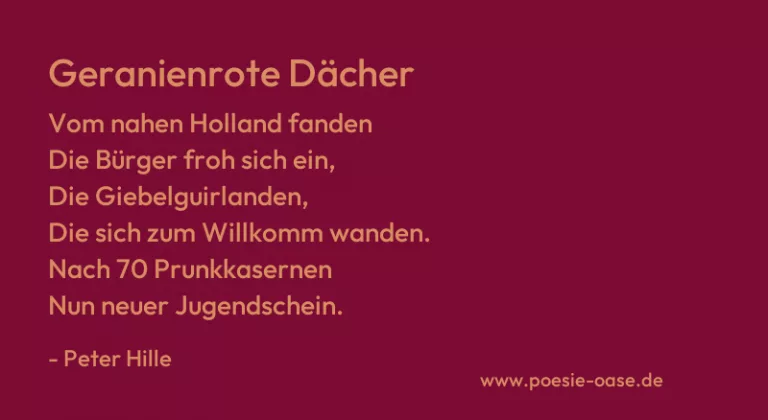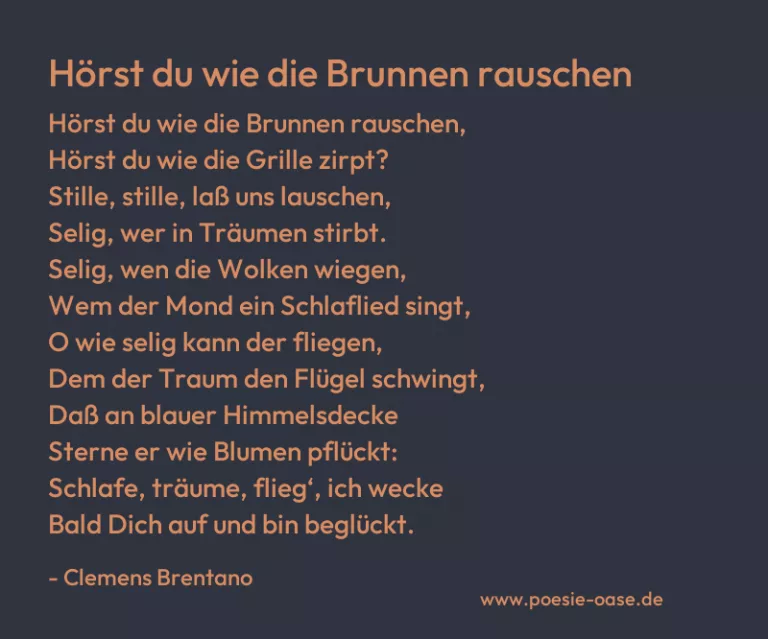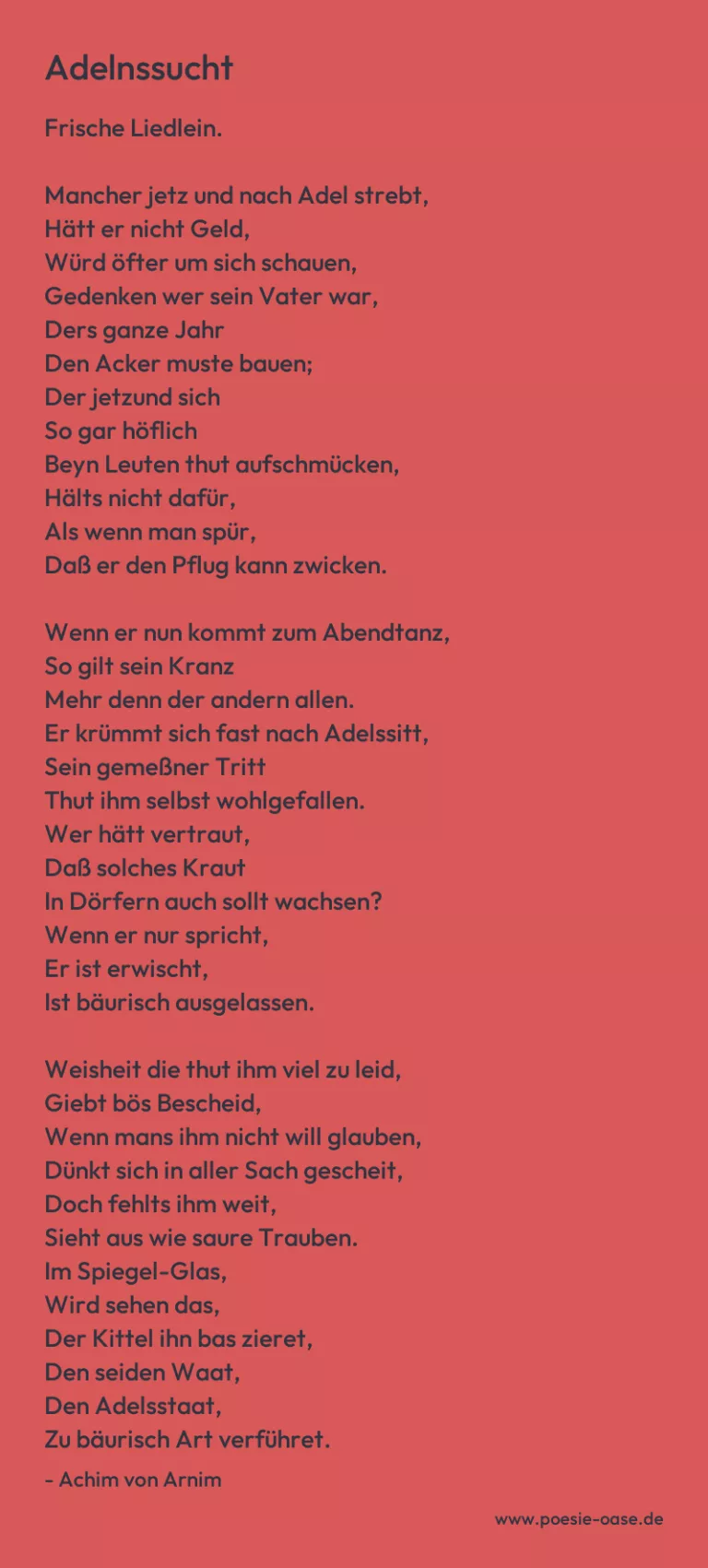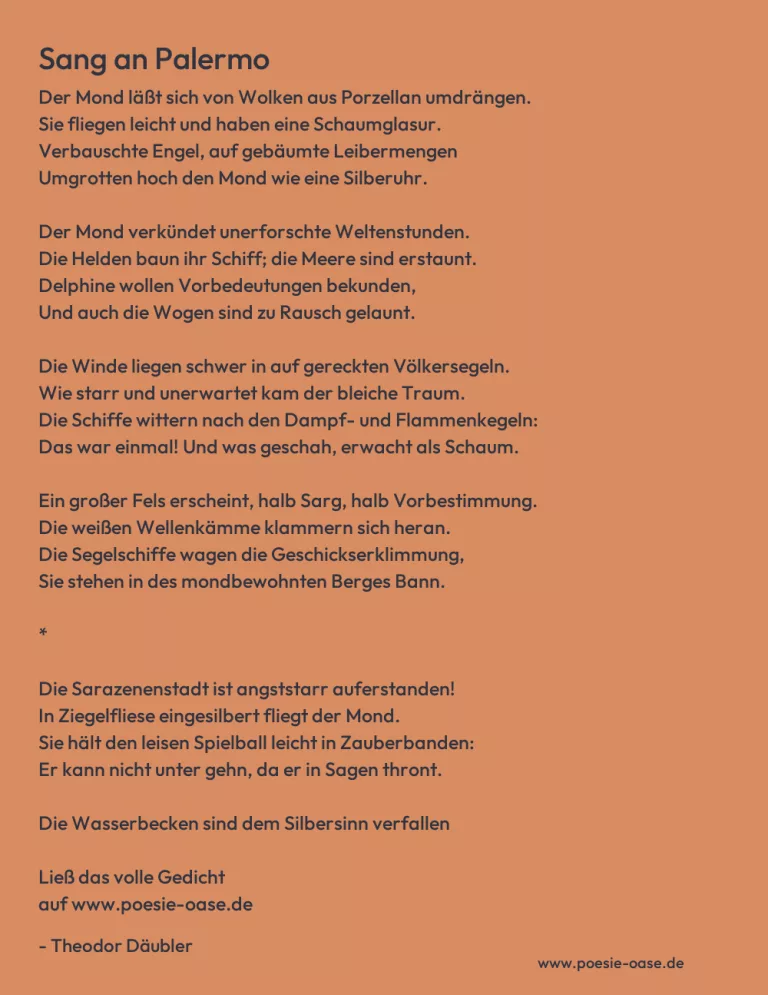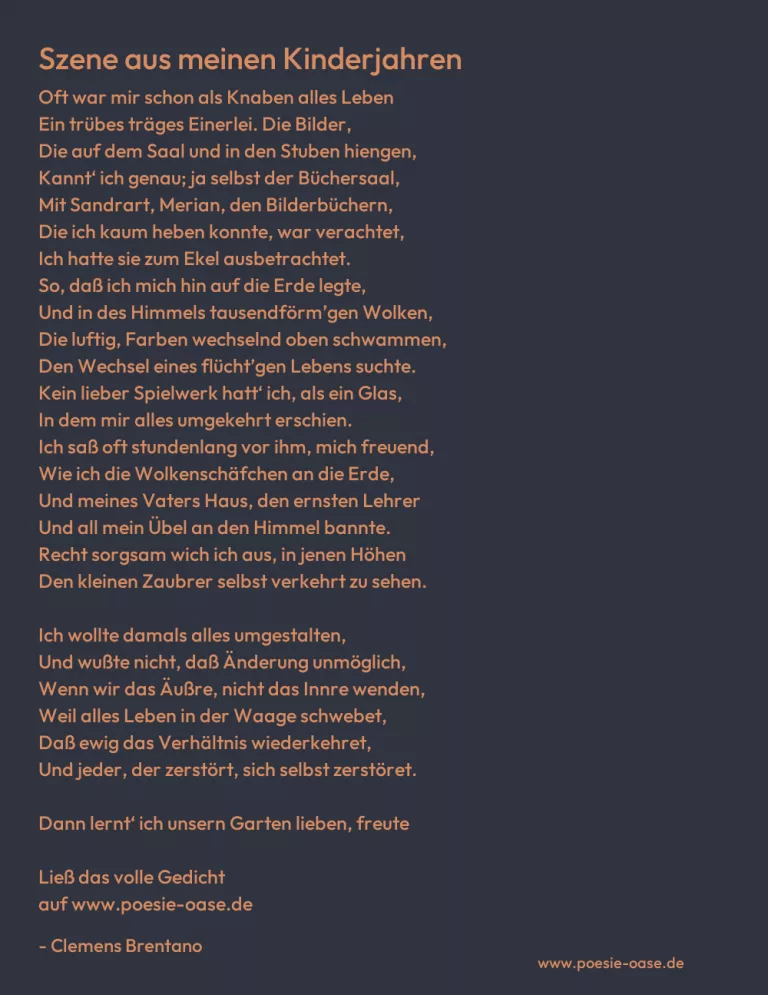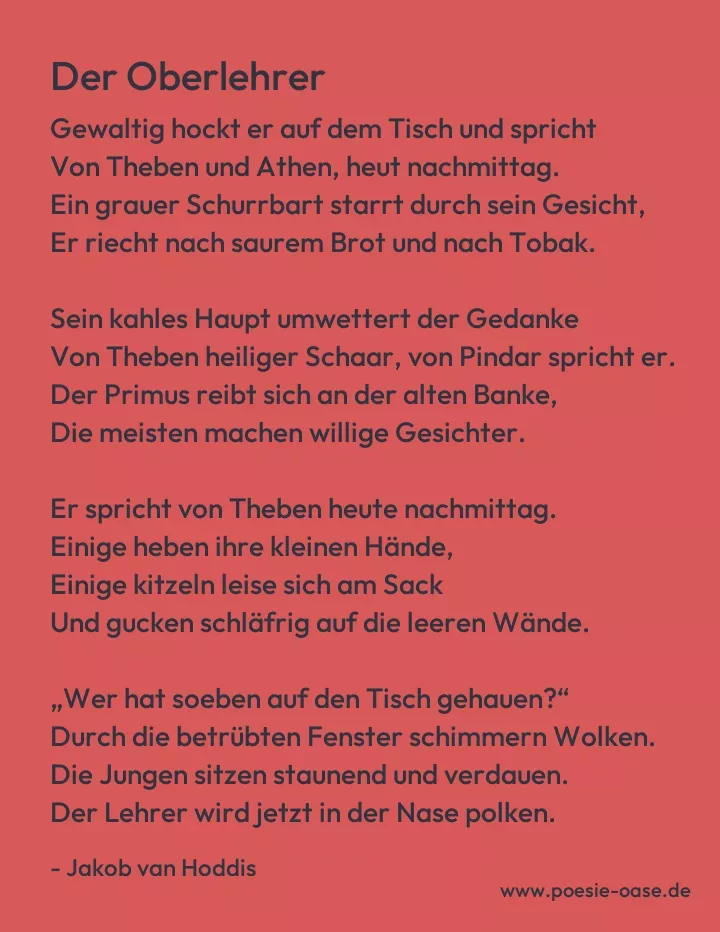Der Oberlehrer
Gewaltig hockt er auf dem Tisch und spricht
Von Theben und Athen, heut nachmittag.
Ein grauer Schurrbart starrt durch sein Gesicht,
Er riecht nach saurem Brot und nach Tobak.
Sein kahles Haupt umwettert der Gedanke
Von Theben heiliger Schaar, von Pindar spricht er.
Der Primus reibt sich an der alten Banke,
Die meisten machen willige Gesichter.
Er spricht von Theben heute nachmittag.
Einige heben ihre kleinen Hände,
Einige kitzeln leise sich am Sack
Und gucken schläfrig auf die leeren Wände.
„Wer hat soeben auf den Tisch gehauen?“
Durch die betrübten Fenster schimmern Wolken.
Die Jungen sitzen staunend und verdauen.
Der Lehrer wird jetzt in der Nase polken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
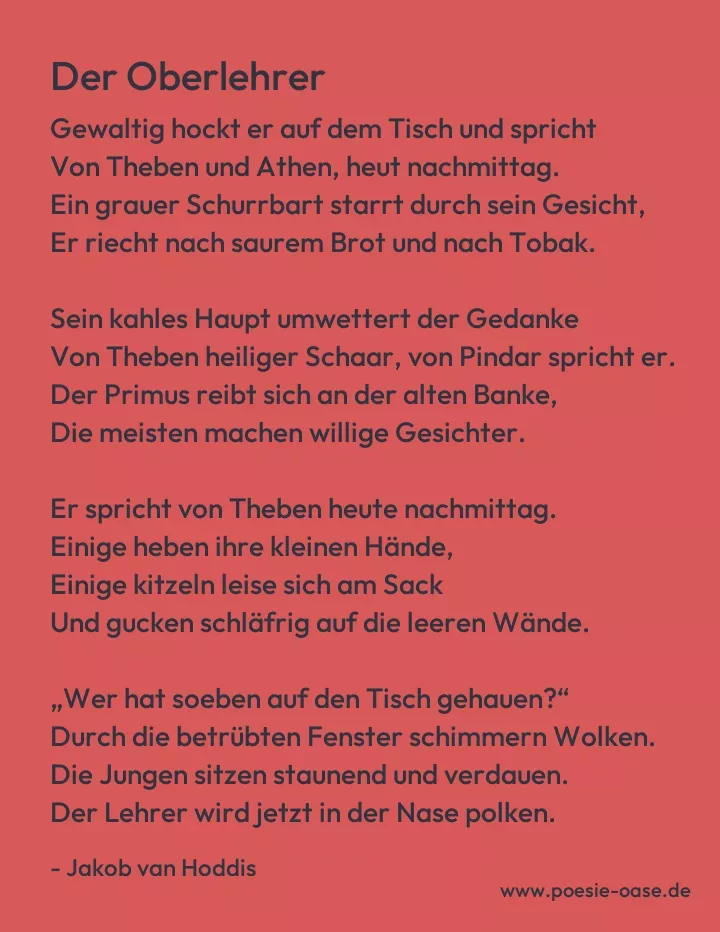
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Oberlehrer“ von Jakob van Hoddis ist eine satirische und zugleich bittere Milieustudie, die den Schulalltag und die Figur eines altmodischen Lehrers kritisch darstellt. Der „Oberlehrer“ wird gleich zu Beginn als übermächtig und schwerfällig beschrieben: „gewaltig hockt er auf dem Tisch“, was ihn als autoritäre und überlebensgroße Figur erscheinen lässt, die sich an überlieferten Stoffen wie „Theben“ und „Athen“ festklammert. Doch trotz der scheinbaren Größe wirken seine körperlichen Details – der „graue Schurrbart“, der Geruch nach „sauren Brot“ und „Tobak“ – schäbig und abstoßend.
Die Atmosphäre im Klassenraum ist von einer lähmenden Routine geprägt. Der Lehrer spricht unablässig von „Theben heiliger Schaar“, während die Schüler innerlich längst abwesend sind. Kleine Gesten – das Reiben an der Bank, das Kitzeln „am Sack“ oder das schläfrige Starren auf die Wände – offenbaren die Entfremdung zwischen dem Oberlehrer und seinen Schülern. Der Unterricht wird zur sinnlosen Pflichtübung, bei der die meisten nur „willige Gesichter“ machen, ohne wirklich teilzuhaben.
Die gestörte Beziehung zwischen Lehrer und Schülern kulminiert in der Szene, als jemand auf den Tisch haut und der Oberlehrer vergeblich versucht, Autorität zurückzugewinnen. Während draußen „betrübte“ Wolken durch die Fenster schimmern, sinkt die Szene vollends ins Groteske, als der Lehrer schließlich „in der Nase polkt“. Damit entlarvt Hoddis die Lehrfigur endgültig als eine Karikatur des Bildungsbürgertums, das sich zwischen angestaubtem Pathos und banaler Körperlichkeit verliert.
„Der Oberlehrer“ kritisiert so auf lakonische Weise den leblosen, formalistischen Schulbetrieb und zeichnet ein humorvoll-deprimierendes Bild einer Institution, in der große Bildungsideale in einer erstarrten Lehrpraxis verkümmern. Das Gedicht lebt von seinem scharfen Blick für Details und der subtilen Ironie gegenüber der Diskrepanz zwischen erhobenem Anspruch und banaler Realität.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.