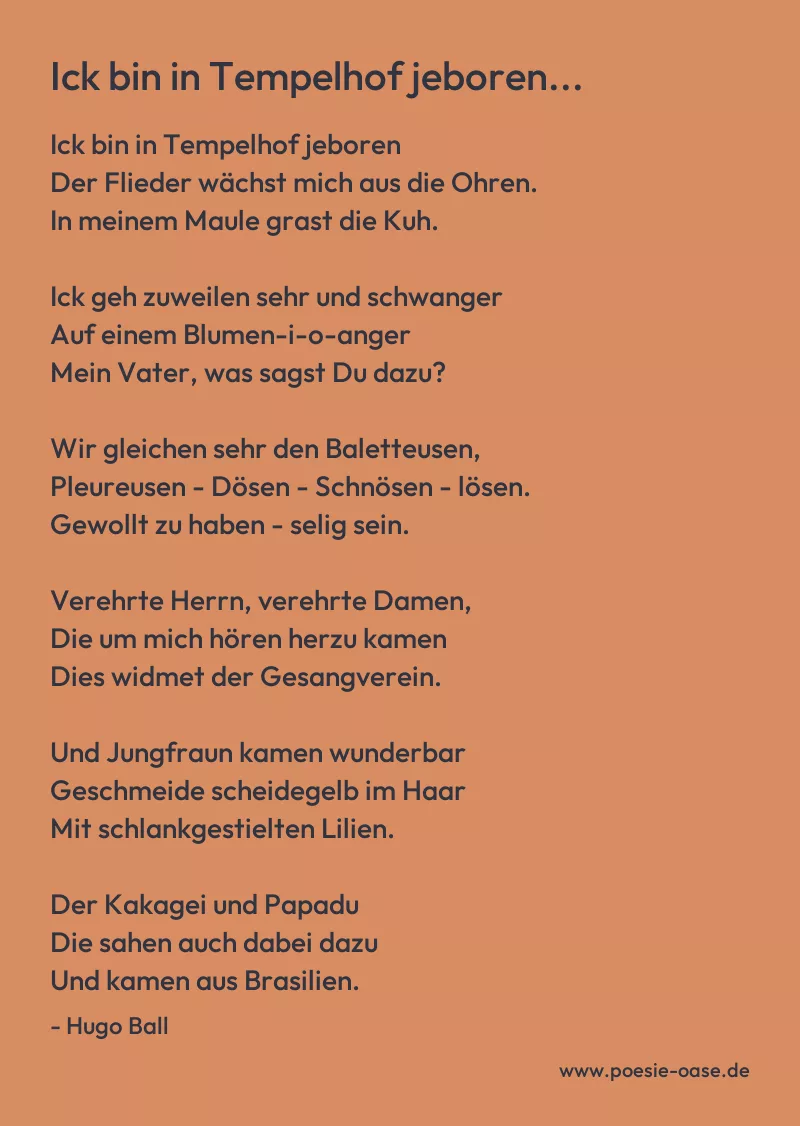Ick bin in Tempelhof jeboren…
Ick bin in Tempelhof jeboren
Der Flieder wächst mich aus die Ohren.
In meinem Maule grast die Kuh.
Ick geh zuweilen sehr und schwanger
Auf einem Blumen-i-o-anger
Mein Vater, was sagst Du dazu?
Wir gleichen sehr den Baletteusen,
Pleureusen – Dösen – Schnösen – lösen.
Gewollt zu haben – selig sein.
Verehrte Herrn, verehrte Damen,
Die um mich hören herzu kamen
Dies widmet der Gesangverein.
Und Jungfraun kamen wunderbar
Geschmeide scheidegelb im Haar
Mit schlankgestielten Lilien.
Der Kakagei und Papadu
Die sahen auch dabei dazu
Und kamen aus Brasilien.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
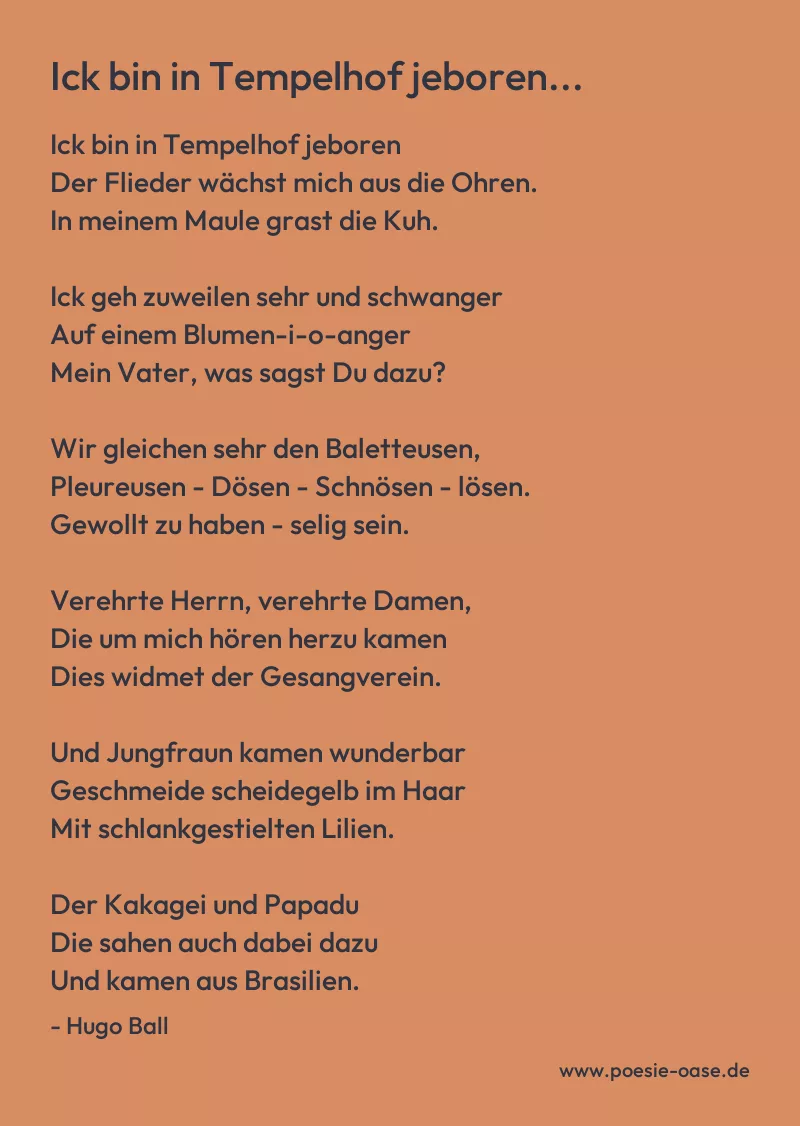
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ick bin in Tempelhof jeboren…” von Hugo Ball ist ein dadaistisches Meisterwerk, das sich durch seine scheinbare Sinnlosigkeit und den spielerischen Umgang mit Sprache auszeichnet. Es ist ein Beispiel für Balls avantgardistische Poetik, die sich von traditionellen literarischen Konventionen abwendet, um neue Ausdrucksformen zu finden. Die Verwendung des Berliner Dialekts, die skurrilen Bilder und die scheinbar zufälligen Reimschemata tragen dazu bei, eine Atmosphäre der Verwirrung und des Humors zu erzeugen, die den Leser herausfordert, über die Bedeutung des Gedichts nachzudenken, anstatt nach einer linearen Erzählung zu suchen.
Die erste Strophe etabliert den Protagonisten, der in Tempelhof geboren wurde und ungewöhnliche Merkmale aufweist – „Der Flieder wächst mich aus die Ohren. In meinem Maule grast die Kuh.“ Diese absurden Bilder setzen den Ton für den Rest des Gedichts und deuten auf eine Welt hin, in der die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt sind. Die Zeilen „Ick geh zuweilen sehr und schwanger / Auf einem Blumen-i-o-anger / Mein Vater, was sagst Du dazu?“ verstärken die surreale Qualität und lassen den Leser in eine Traumwelt eintauchen. Die Frage an den Vater deutet auf eine Suche nach Akzeptanz und Verständnis hin, die jedoch innerhalb dieses Gedichts kaum zu finden ist.
In den folgenden Strophen werden weitere bizarre Elemente eingeführt: „Wir gleichen sehr den Baletteusen, Pleureusen – Dösen – Schnösen – lösen.“ Die Wortspiele und die Aneinanderreihung von unsinnigen Begriffen unterstreichen die dadaistische Absicht, die Konventionen der Sprache zu untergraben. Die Erwähnung des „Gesangvereins“ und die Anrede von „verehrte Herrn, verehrte Damen“ suggerieren eine parodistische Auseinandersetzung mit bürgerlichen Traditionen und gesellschaftlichen Erwartungen. Die Anwesenheit von Jungfrauen mit „schlankgestielten Lilien“ und exotischen Vögeln aus Brasilien erweitert das surreale Universum und verleiht dem Gedicht eine fast karnevaleske Atmosphäre.
Insgesamt ist „Ick bin in Tempelhof jeboren…” eine Dekonstruktion der Sprache und der konventionellen Poesie. Es ist ein Aufruf zur Freiheit, zum Spiel und zur Ironie. Hugo Ball nutzte dieses Gedicht, um die traditionellen Vorstellungen von Kunst und Literatur zu hinterfragen und den Leser dazu zu ermutigen, über die Grenzen der Vernunft hinauszugehen. Die scheinbare Sinnlosigkeit ist dabei ein bewusster Akt der Rebellion, der die konventionellen Formen und Erwartungen der Kunst in Frage stellt. Es ist ein Gedicht, das mehr Fragen stellt, als es beantwortet, und das den Leser dazu anregt, seine eigene Interpretation zu finden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.