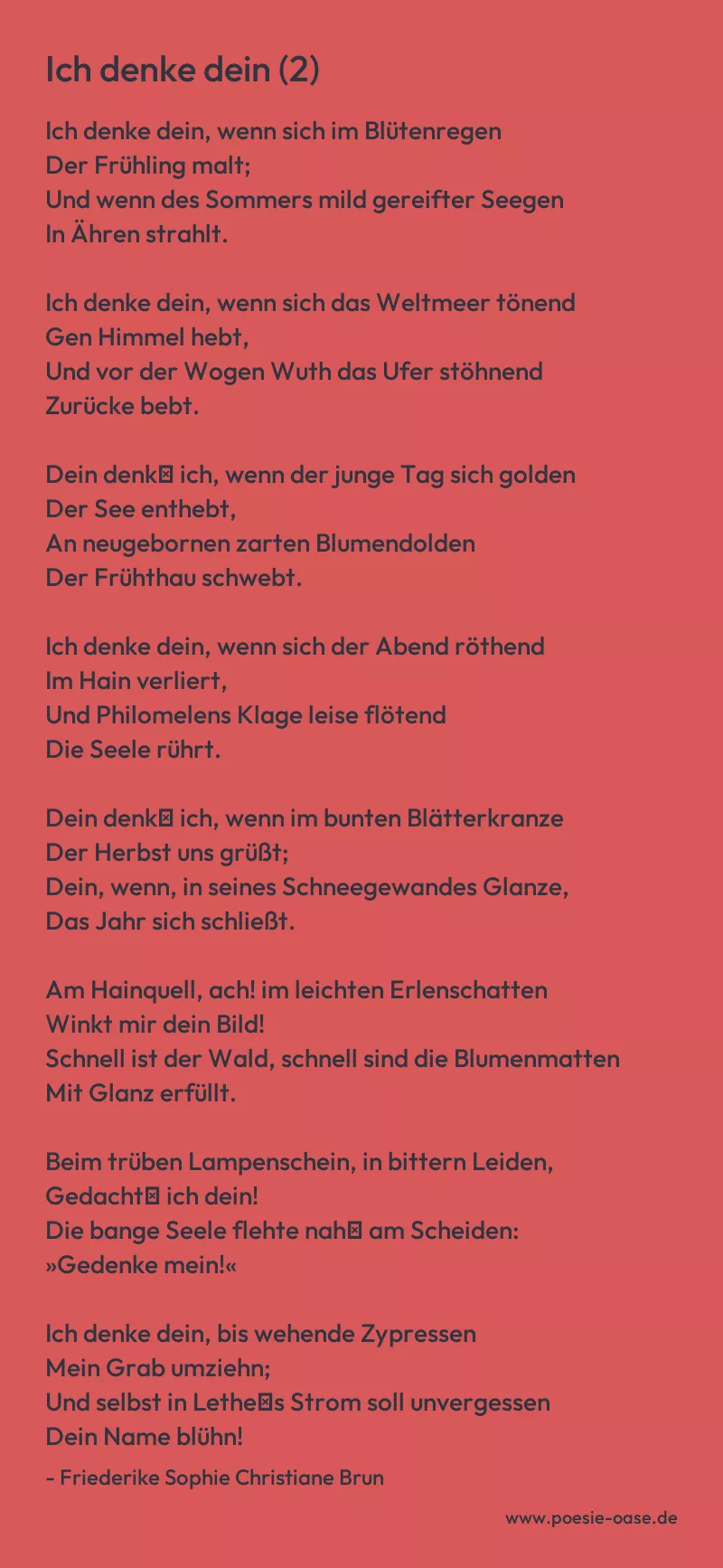Ich denke dein (2)
Ich denke dein, wenn sich im Blütenregen
Der Frühling malt;
Und wenn des Sommers mild gereifter Seegen
In Ähren strahlt.
Ich denke dein, wenn sich das Weltmeer tönend
Gen Himmel hebt,
Und vor der Wogen Wuth das Ufer stöhnend
Zurücke bebt.
Dein denk′ ich, wenn der junge Tag sich golden
Der See enthebt,
An neugebornen zarten Blumendolden
Der Frühthau schwebt.
Ich denke dein, wenn sich der Abend röthend
Im Hain verliert,
Und Philomelens Klage leise flötend
Die Seele rührt.
Dein denk′ ich, wenn im bunten Blätterkranze
Der Herbst uns grüßt;
Dein, wenn, in seines Schneegewandes Glanze,
Das Jahr sich schließt.
Am Hainquell, ach! im leichten Erlenschatten
Winkt mir dein Bild!
Schnell ist der Wald, schnell sind die Blumenmatten
Mit Glanz erfüllt.
Beim trüben Lampenschein, in bittern Leiden,
Gedacht′ ich dein!
Die bange Seele flehte nah′ am Scheiden:
»Gedenke mein!«
Ich denke dein, bis wehende Zypressen
Mein Grab umziehn;
Und selbst in Lethe′s Strom soll unvergessen
Dein Name blühn!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
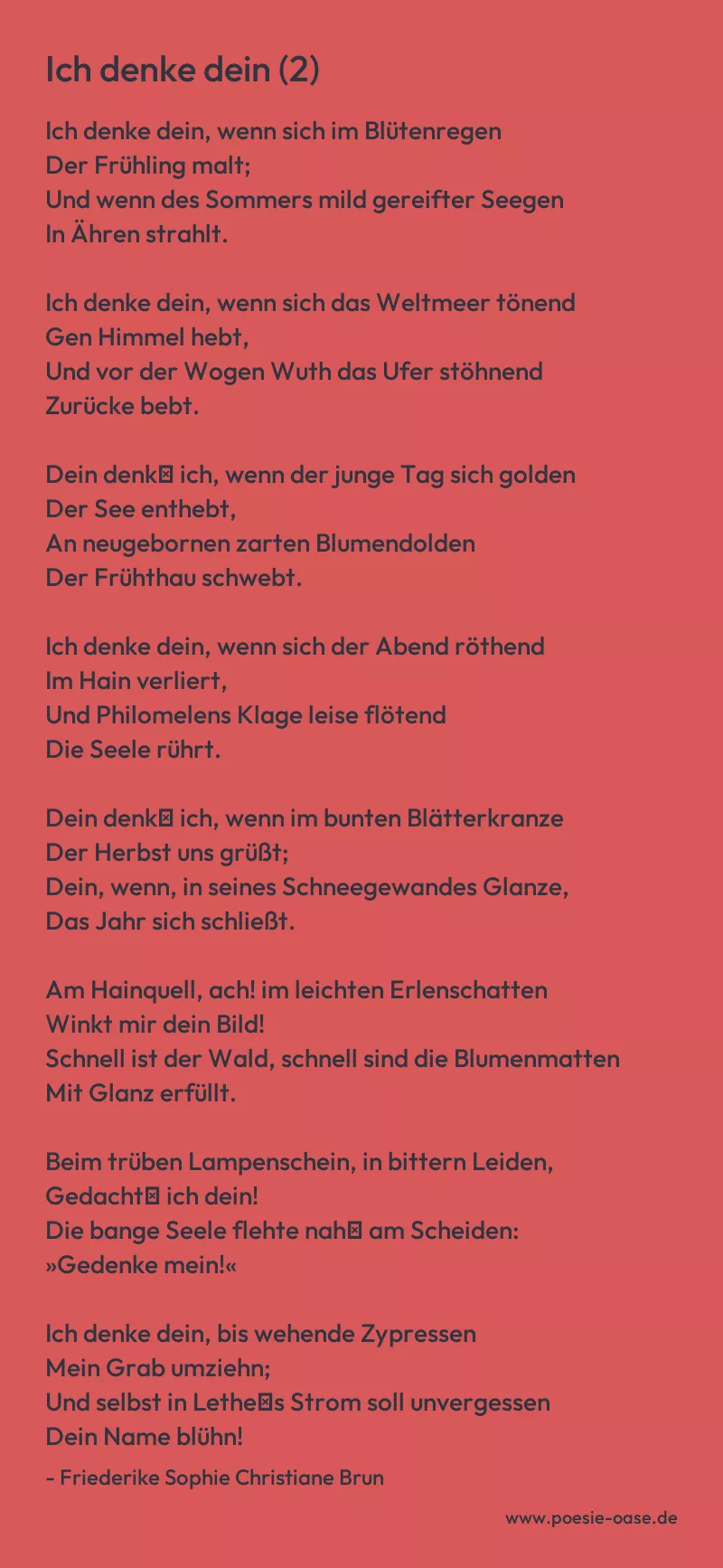
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich denke dein“ von Friederike Sophie Christiane Brun ist eine tief empfundene Liebeserklärung, die sich über die gesamte Bandbreite der Jahreszeiten und der natürlichen Umgebung erstreckt. Es ist eine Ode an die stetige Präsenz des Geliebten im Geist der Dichterin, unabhängig von Ort und Zeit. Das Gedicht beginnt mit der Beschwörung des Frühlings und des Sommers und dehnt sich dann auf das stürmische Meer, den Sonnenaufgang, den Abend, den Herbst und schließlich den Winter aus. Jede Strophe verbindet die Erinnerung an den Geliebten mit einem bestimmten Naturereignis, wodurch die tiefe Verwurzelung der Liebe in der Welt verdeutlicht wird.
Die zentrale Idee des Gedichts ist die Unauflöslichkeit der Liebe. Das „Ich“ der Dichterin denkt ständig an den Geliebten, in Zeiten des Glücks und der Schönheit sowie in Momenten der Trauer und des Abschieds. Die Natur dient hier als Metapher für die Unvergänglichkeit der Liebe, denn so wie die Jahreszeiten kommen und gehen, bleibt die Erinnerung an den Geliebten lebendig und gegenwärtig. Die letzte Strophe, die mit dem Bild der Zypressen und des Flusses Lethe endet, unterstreicht diese Unvergänglichkeit noch weiter. Selbst im Tod, bis hin zur Unsterblichkeit, soll der Name des Geliebten in Erinnerung bleiben.
Die Verwendung von Bildern, die sowohl Schönheit als auch Vergänglichkeit implizieren, wie der „Blütenregen“ des Frühlings oder der „bunten Blätterkranz“ des Herbstes, verleiht dem Gedicht eine zusätzliche Tiefe. Die Dichterin scheint sich der Flüchtigkeit des Lebens bewusst zu sein, aber die Liebe, die sie empfindet, überwindet diese Vergänglichkeit. Die Natur dient als Spiegelbild der vielfältigen Emotionen, die die Liebe auslöst – von Freude und Glückseligkeit bis hin zu Melancholie und Trauer. Die Kontinuität des Denkens an den Geliebten, selbst in den dunkelsten Stunden, wie im trüben „Lampenschein“ oder in „bittern Leiden“, zeugt von der tiefen Verbundenheit und dem Trost, den die Liebe bietet.
Die Struktur des Gedichts, das sich in gleichmäßigen Strophen aufbaut und die verschiedenen Jahreszeiten und Gemütszustände abdeckt, verstärkt den Eindruck der Beständigkeit und Ganzheit der Liebe. Die sanfte Melancholie, die in den Versen mitschwingt, besonders wenn die Dichterin an den „Scheiden“ denkt, verleiht dem Gedicht eine besondere Intensität. Die Verwendung von einfachen, klaren Worten und Bildern macht das Gedicht zugänglich und universell. Es ist ein Lied der Sehnsucht, der Erinnerung und der unerschütterlichen Liebe, das die Grenzen von Zeit und Raum überwindet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.