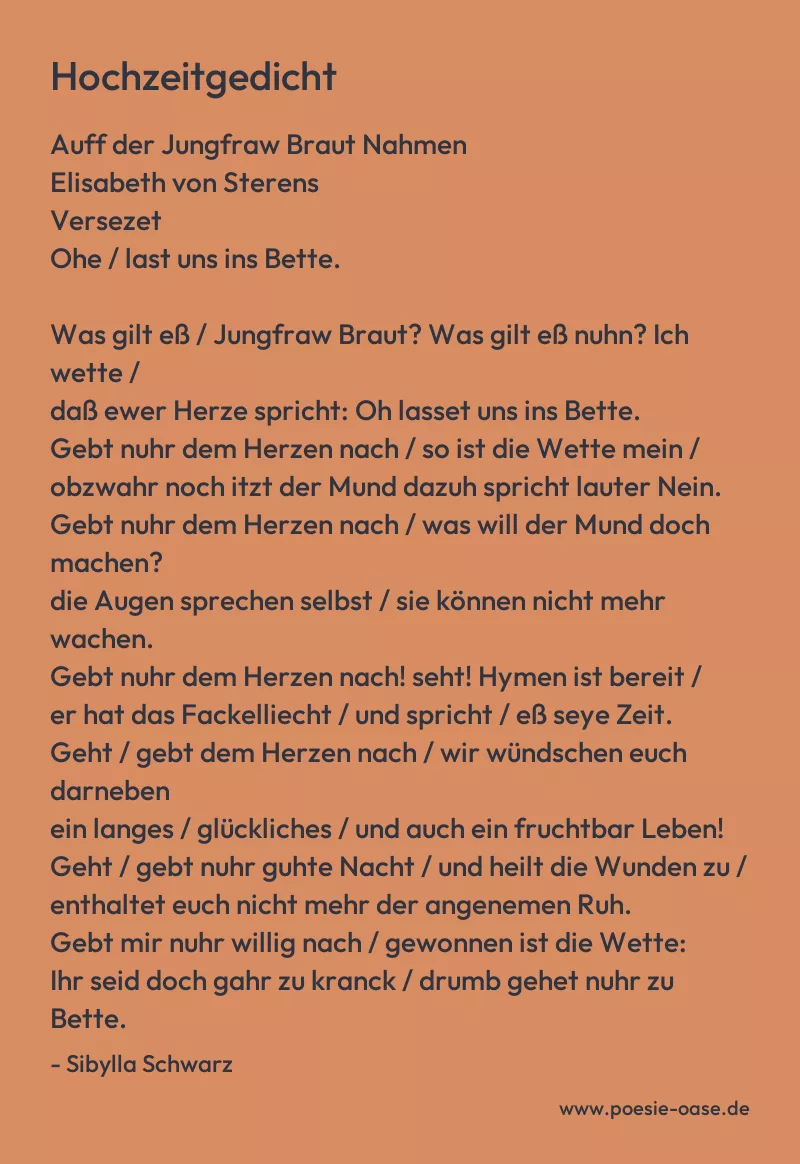Hochzeitgedicht
Auff der Jungfraw Braut Nahmen
Elisabeth von Sterens
Versezet
Ohe / last uns ins Bette.
Was gilt eß / Jungfraw Braut? Was gilt eß nuhn? Ich wette /
daß ewer Herze spricht: Oh lasset uns ins Bette.
Gebt nuhr dem Herzen nach / so ist die Wette mein /
obzwahr noch itzt der Mund dazuh spricht lauter Nein.
Gebt nuhr dem Herzen nach / was will der Mund doch machen?
die Augen sprechen selbst / sie können nicht mehr wachen.
Gebt nuhr dem Herzen nach! seht! Hymen ist bereit /
er hat das Fackelliecht / und spricht / eß seye Zeit.
Geht / gebt dem Herzen nach / wir wündschen euch darneben
ein langes / glückliches / und auch ein fruchtbar Leben!
Geht / gebt nuhr guhte Nacht / und heilt die Wunden zu /
enthaltet euch nicht mehr der angenemen Ruh.
Gebt mir nuhr willig nach / gewonnen ist die Wette:
Ihr seid doch gahr zu kranck / drumb gehet nuhr zu Bette.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
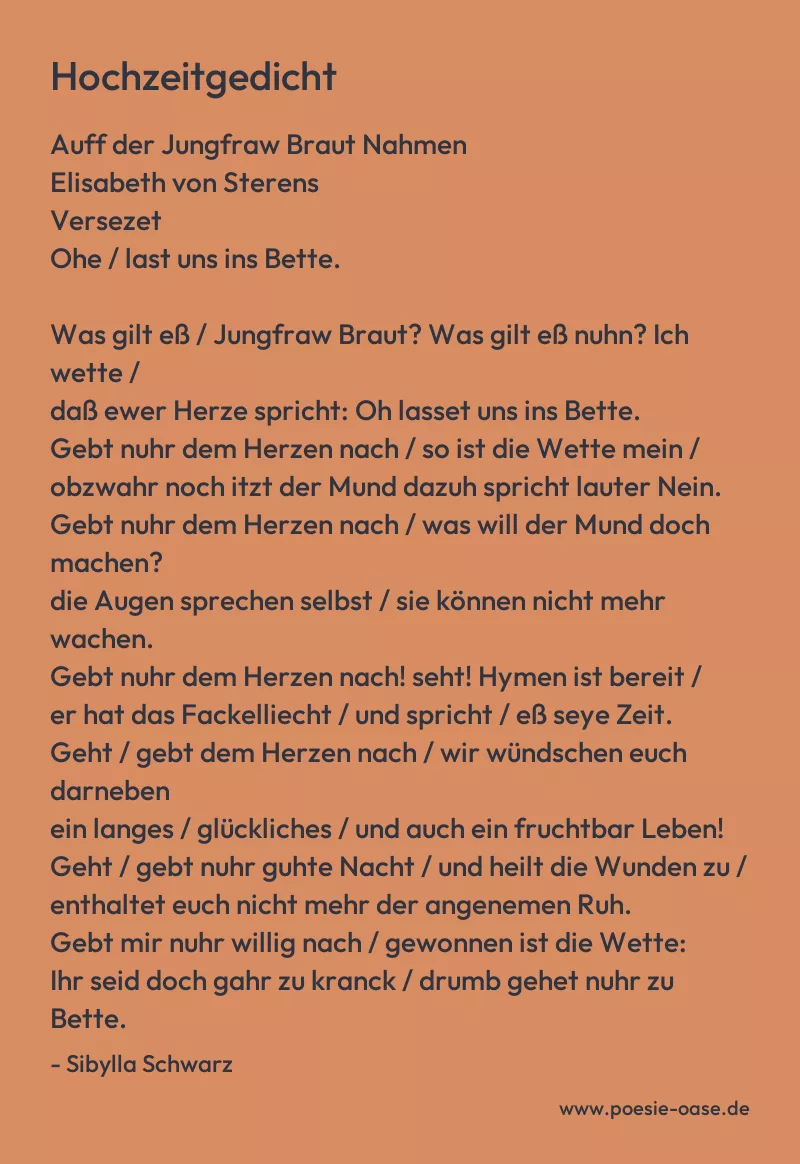
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hochzeitgedicht“ von Sibylla Schwarz ist eine spielerische und humorvolle Aufforderung an die Braut Elisabeth von Sterens, sich ihrem Bräutigam hinzugeben und die Hochzeitsnacht zu genießen. Der Text, der in der barocken Tradition der Gelegenheitsdichtung verfasst ist, präsentiert eine klare, fast plakative Botschaft: „Ohe / last uns ins Bette“. Diese Zeile fungiert als Kernbotschaft, die immer wieder variiert und durch unterschiedliche Argumentationen bekräftigt wird.
Die Dichterin verwendet eine Mischung aus Zuspruch, Überredung und leichter Neckerei, um die Braut zu ermutigen, ihren Zögling aufzugeben. Der Wechsel zwischen rhetorischen Fragen wie „Was gilt eß / Jungfraw Braut? Was gilt eß nuhn?“ und direkten Aufforderungen wie „Gebt nuhr dem Herzen nach!“ erzeugt eine lebendige, fast theatralische Atmosphäre. Die Metapher vom „Herzen“ als dem wahren Impulsgeber, der dem „Mund“ und den „Augen“ überlegen ist, die vielleicht noch widerwillig sind, verleiht dem Gedicht eine subtile psychologische Ebene. Es deutet an, dass die Braut vielleicht noch Zögern empfindet, aber ihre innersten Wünsche bereits nach der Vereinigung streben.
Bemerkenswert ist die Verwendung von Anspielungen auf die traditionellen Hochzeitsrituale, insbesondere die Präsenz von Hymen, dem Gott der Ehe, der mit dem „Fackelliecht“ zur Stelle ist. Dieser bildhafte Einsatz verstärkt die festliche und feierliche Atmosphäre. Die abschließenden Wünsche nach einem „langen / glücklichen / und auch ein fruchtbar Leben!“ sind ein klassisches Element von Hochzeitsglückwünschen und unterstreichen die gesellschaftliche Konvention, die in diesem Gedicht gefeiert wird. Der Text gipfelt in dem Schlusssatz „Ihr seid doch gahr zu kranck / drumb gehet nuhr zu Bette“, der die Braut liebevoll zur Ruhe und zum Genuss der Hochzeitsnacht auffordert.
Die Relevanz des Gedichts liegt in seiner Fähigkeit, eine intime, private Situation in eine öffentliche, humorvolle Botschaft zu verwandeln. Es ist ein Beispiel dafür, wie in der Barockzeit Dichtung dazu genutzt wurde, um Feste zu feiern, Konventionen zu bestätigen und die Freuden des menschlichen Lebens zu preisen. Die einfache, aber effektive Struktur und die direkte Sprache machen das Gedicht sowohl zugänglich als auch wirkungsvoll. Es ist ein Zeugnis für die Lebensfreude und die spielerische Leichtigkeit, die auch in einer ernsten Angelegenheit wie der Ehe ihren Platz finden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.