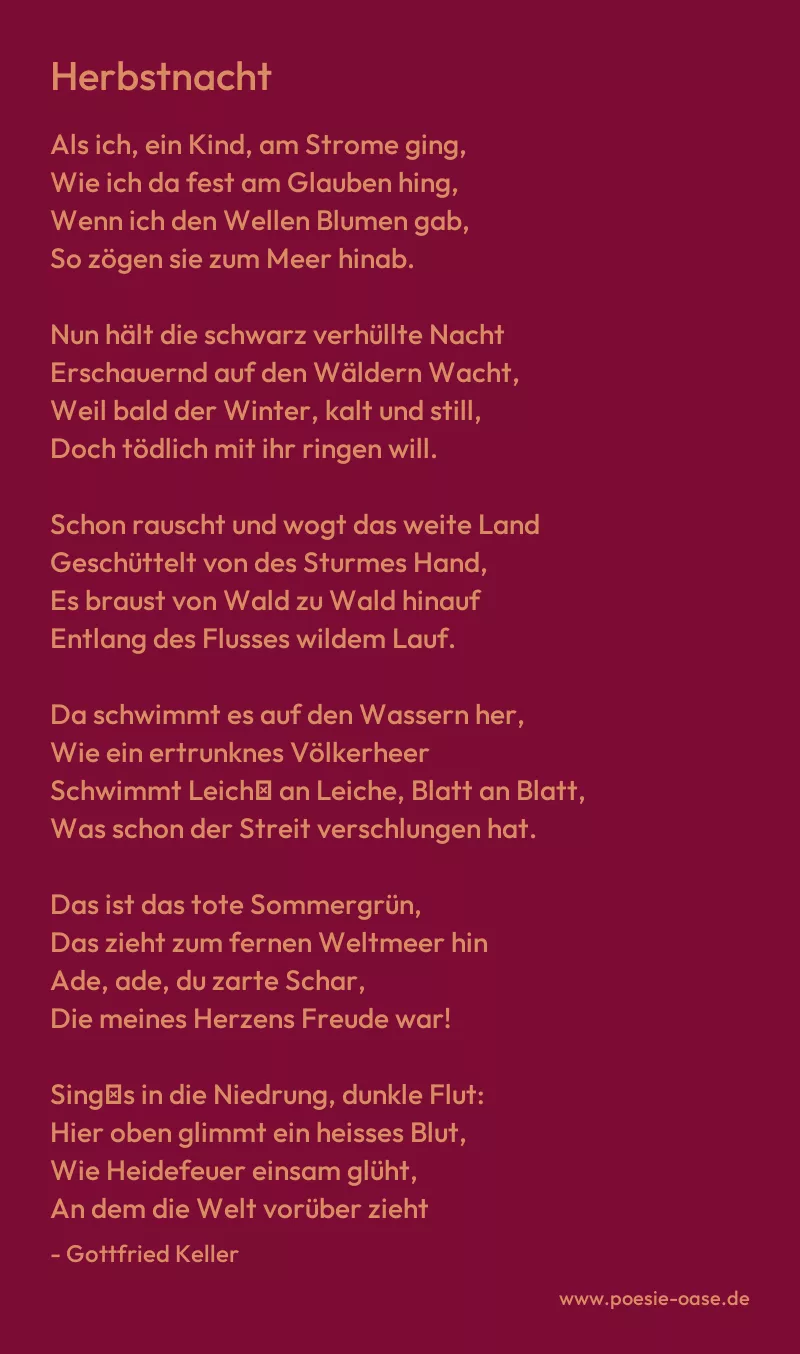Einsamkeit, Feiern, Feiertage, Freiheit & Sehnsucht, Gegenwart, Harmonie, Himmel & Wolken, Liebe & Romantik, Märchen & Fantasie, Mythen & Legenden, Natur, Russland
Herbstnacht
Als ich, ein Kind, am Strome ging,
Wie ich da fest am Glauben hing,
Wenn ich den Wellen Blumen gab,
So zögen sie zum Meer hinab.
Nun hält die schwarz verhüllte Nacht
Erschauernd auf den Wäldern Wacht,
Weil bald der Winter, kalt und still,
Doch tödlich mit ihr ringen will.
Schon rauscht und wogt das weite Land
Geschüttelt von des Sturmes Hand,
Es braust von Wald zu Wald hinauf
Entlang des Flusses wildem Lauf.
Da schwimmt es auf den Wassern her,
Wie ein ertrunknes Völkerheer
Schwimmt Leich′ an Leiche, Blatt an Blatt,
Was schon der Streit verschlungen hat.
Das ist das tote Sommergrün,
Das zieht zum fernen Weltmeer hin
Ade, ade, du zarte Schar,
Die meines Herzens Freude war!
Sing′s in die Niedrung, dunkle Flut:
Hier oben glimmt ein heisses Blut,
Wie Heidefeuer einsam glüht,
An dem die Welt vorüber zieht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
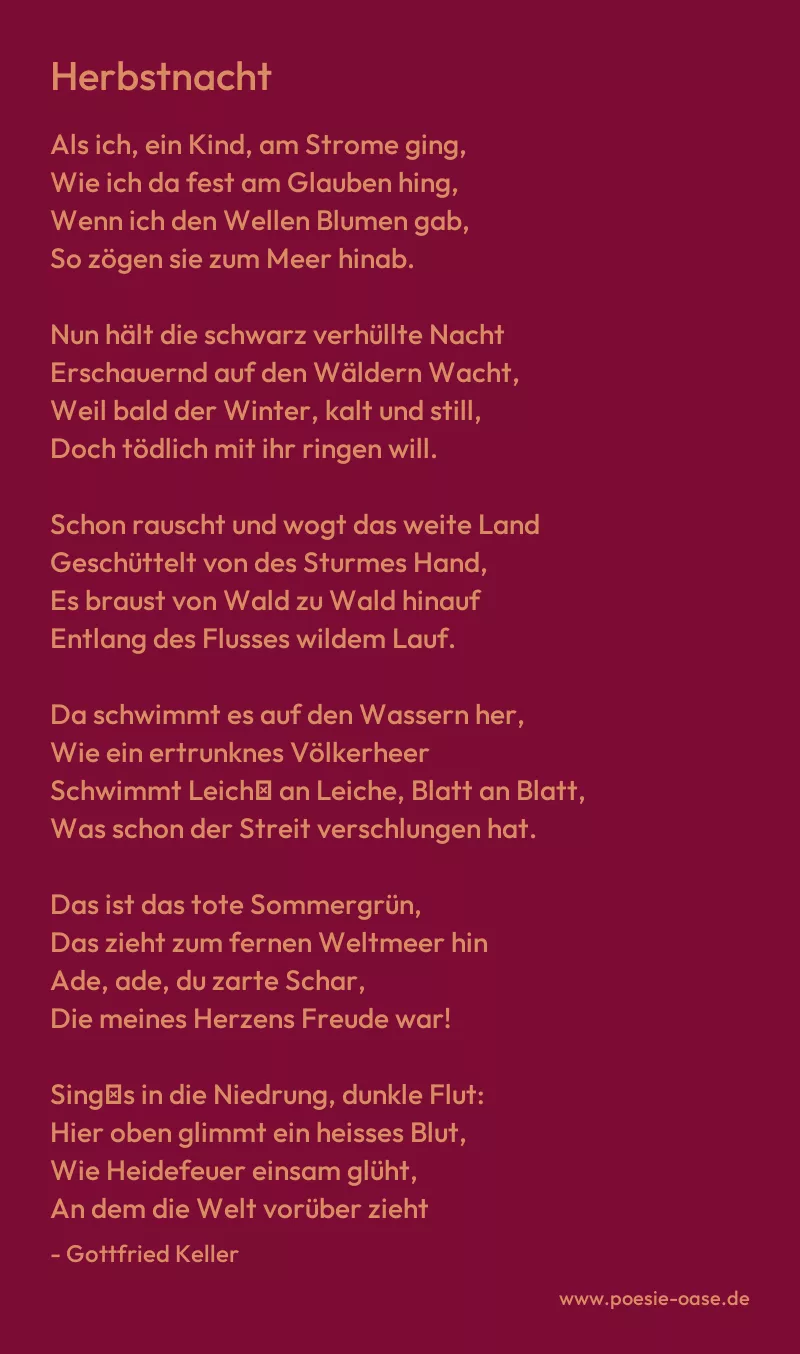
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Herbstnacht“ von Gottfried Keller ist eine melancholische Reflexion über den Lauf der Zeit, den Verlust und die Vergänglichkeit. Es beginnt mit einer kindlichen Erinnerung an unbeschwerte Tage, in denen die Welt einfach und voller Glauben war. Die Zeilen „Als ich, ein Kind, am Strome ging, / Wie ich da fest am Glauben hing, / Wenn ich den Wellen Blumen gab, / So zögen sie zum Meer hinab“ beschwören eine naive, idyllische Vergangenheit herauf, in der die Natur als zuverlässiger Begleiter diente und die Welt mit kindlicher Unschuld wahrgenommen wurde. Die Blumen, die dem Fluss übergeben werden, symbolisieren die Hoffnung und die Unbekümmertheit dieser Zeit, die jedoch bereits dem Lauf der Zeit unterworfen sind und ins Meer, also in die Unendlichkeit, getragen werden.
Der zweite Teil des Gedichts wechselt in die Gegenwart und beschreibt die heraufziehende Herbstnacht, die von einer düsteren Stimmung geprägt ist. Die „schwarz verhüllte Nacht“ wird als Wächterin über den Wäldern dargestellt, die den bevorstehenden Winter ankündigt. Dieser Kampf zwischen Sommer und Winter, zwischen Leben und Tod, wird personifiziert und als ein „Ringen“ beschrieben. Das stürmische Geschehen in der Natur spiegelt die innere Zerrissenheit des lyrischen Ichs wider, das sich der Vergänglichkeit bewusst wird. Die „geschüttelte“ Landschaft und der „wilde Lauf“ des Flusses zeugen von der Zerstörung und dem Verfall, die mit dem Herbst einhergehen. Die Zeilen verstärken das Gefühl der Melancholie und des Abschieds, das in der Natur zu spüren ist.
Die folgenden Strophen verdeutlichen das Ausmaß des Verlustes, der mit dem Herbst verbunden ist. Das Bild des Flusses, der von „ertrunkenen“ Blättern bedeckt ist, die wie ein „Völkerheer“ treiben, ist ein eindringliches Symbol für den Tod und die Vergänglichkeit. Die Blätter, die einst das „Sommergrün“ bildeten, werden nun vom Fluss davongetragen, ein Bild, das die Auflösung und den Zerfall der Natur unterstreicht. Der Abschied von der „zarten Schar“, den Blättern, die einst die Freude des Herzens waren, verdeutlicht das tiefe Bedauern des Sprechers über den Verlust der Schönheit und Lebendigkeit des Sommers.
Die letzte Strophe offenbart die innere Auseinandersetzung des lyrischen Ichs mit der Vergänglichkeit. Während die Natur dem Verfall preisgegeben ist, glimmt in der Dunkelheit ein „heisses Blut“, ein „Heidefeuer“. Dieses Bild der „einsamen“ Glut symbolisiert die Hoffnung, die Erinnerung und die innere Wärme, die trotz des Verlustes und der Kälte der Welt erhalten bleiben. Das lyrische Ich, allein mit seinen Gefühlen, blickt auf die vorbeiziehende Welt, die vom Fluss und dem Lauf der Zeit getragen wird. Es drückt die tiefe Trauer über den Verlust des Sommers und des Lebensgefühls aus, aber auch die Erkenntnis, dass die Erinnerung und die eigene innere Welt existieren und überdauern.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.