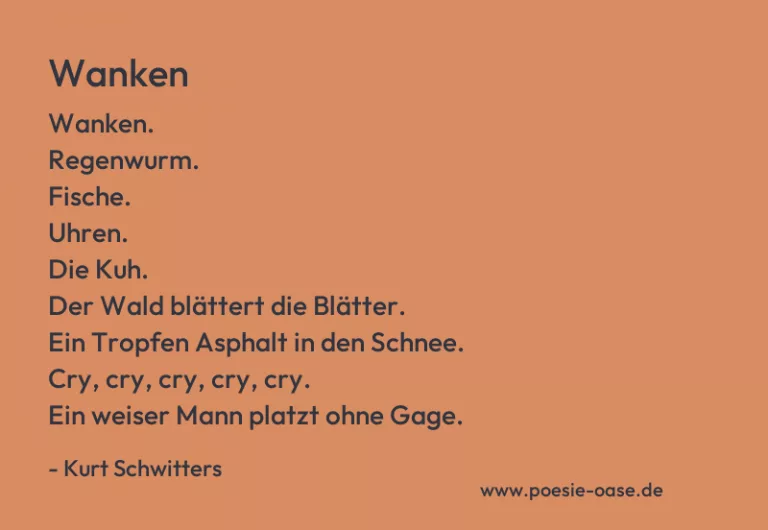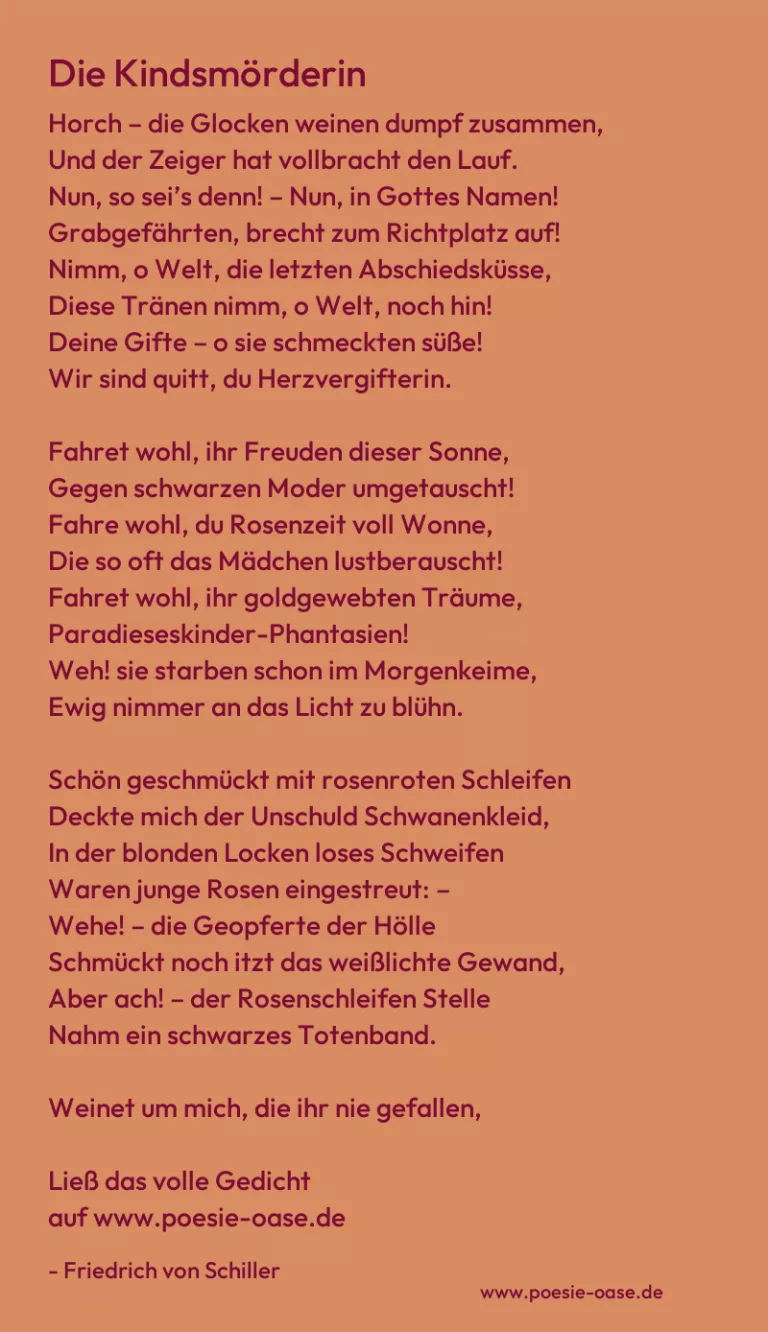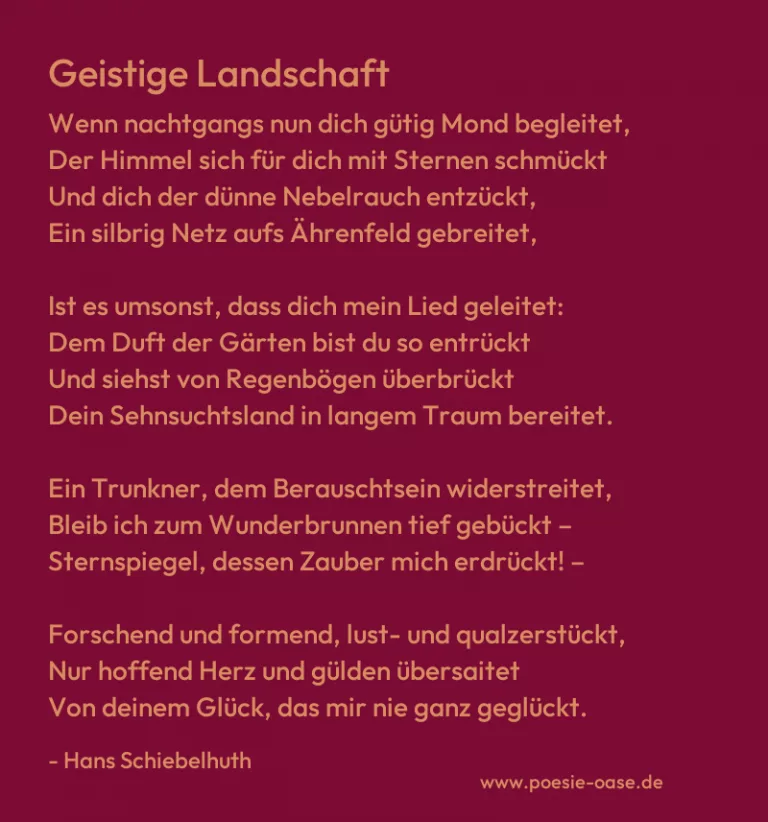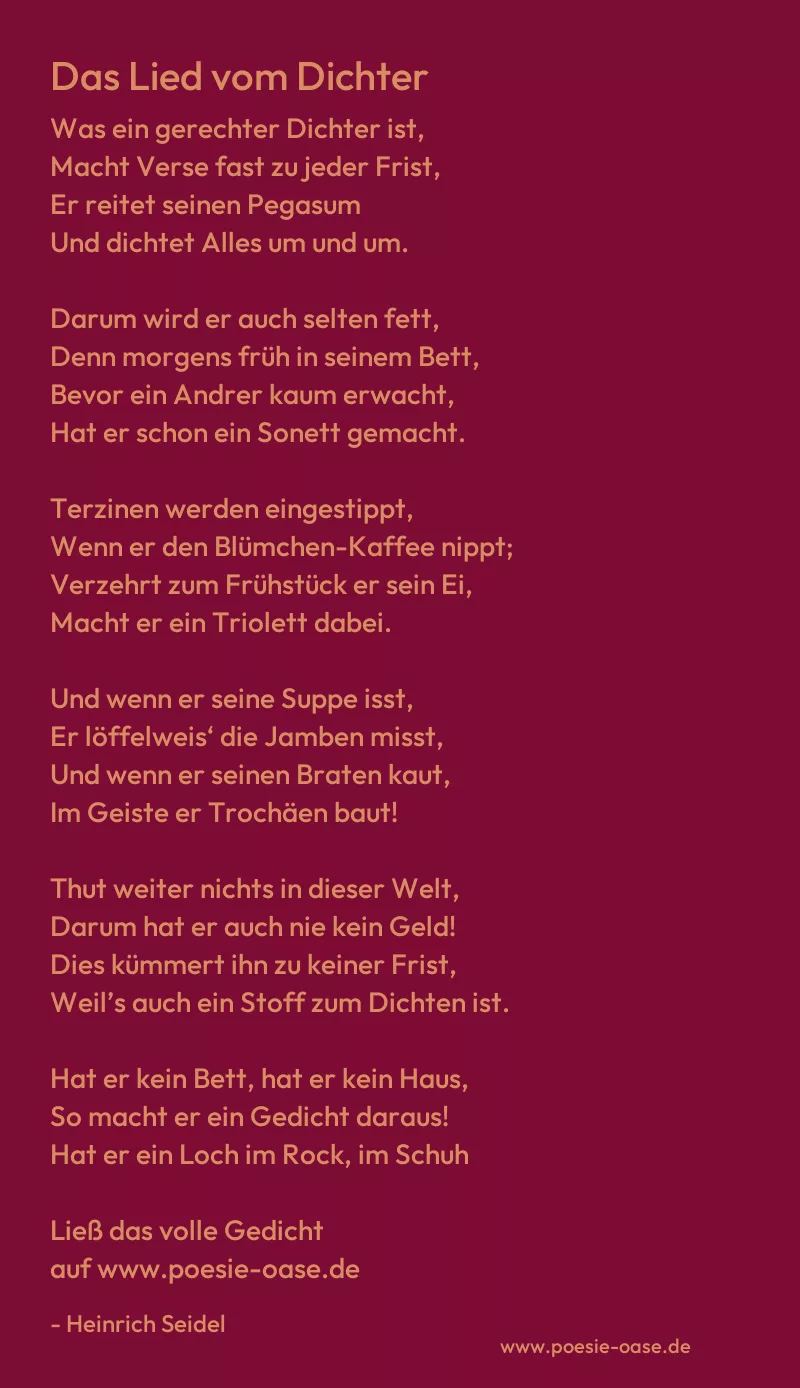Was ein gerechter Dichter ist,
Macht Verse fast zu jeder Frist,
Er reitet seinen Pegasum
Und dichtet Alles um und um.
Darum wird er auch selten fett,
Denn morgens früh in seinem Bett,
Bevor ein Andrer kaum erwacht,
Hat er schon ein Sonett gemacht.
Terzinen werden eingestippt,
Wenn er den Blümchen-Kaffee nippt;
Verzehrt zum Frühstück er sein Ei,
Macht er ein Triolett dabei.
Und wenn er seine Suppe isst,
Er löffelweis‘ die Jamben misst,
Und wenn er seinen Braten kaut,
Im Geiste er Trochäen baut!
Thut weiter nichts in dieser Welt,
Darum hat er auch nie kein Geld!
Dies kümmert ihn zu keiner Frist,
Weil’s auch ein Stoff zum Dichten ist.
Hat er kein Bett, hat er kein Haus,
So macht er ein Gedicht daraus!
Hat er ein Loch im Rock, im Schuh
So stopft er es mit Strophen zu!
Nichts ist zu gross, nichts ist zu klein:
Er sperrt’s in seine Verse ein.
Nur was man nicht besingen kann,
Das sieht er als ein Neutrum an.
Der Frosch, der auf der Wiese hüpft,
Die Maus, die in ihr Löchlein schlüpft,
Der Käfer, der im Teich ersoff,
Sind alle miteinander „Stoff“.
Was kühn noch in die Lüfte strebt,
Was schon die Erde umgebebt,
Ob heil und ganz, ob kurz und klein –
In seinen Vers muss es hinein!
So zählt er seine Silben ab
Vergnügt bis an sein kühles Grab,
Und unter seinen letzten Band
Schreibt „finis“ hin des Todes Hand.
Was ein gerechter Dichter ist,
Benutzet auch die letzte Frist,
Macht eine Grabschrift noch zuvor
Und legt sich auf sein Dichterohr.
Die Leute stehen trauervoll
Dann um sein Grab und schauervoll.
Ein Jeder denkt sich, was er will,
Doch meist: „Gottlob, nun ist er still!“
Es wächst dann in der Jahre lauf
Dort eine Zitterpappel auf;
Und ob der Wind schläft oder wacht:
Die Blätter flüstern Tag und Nacht!