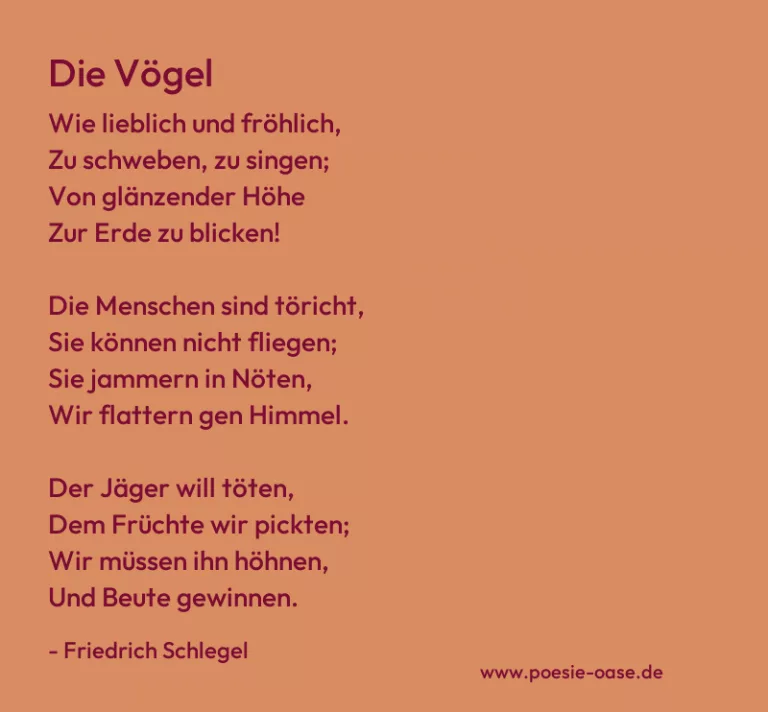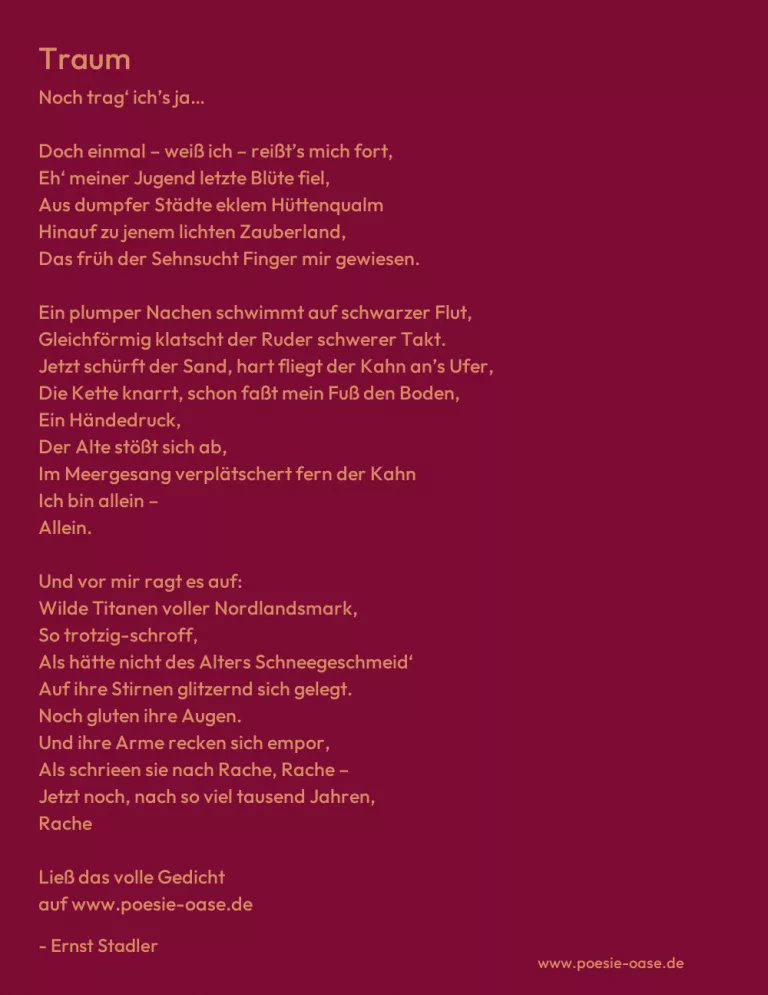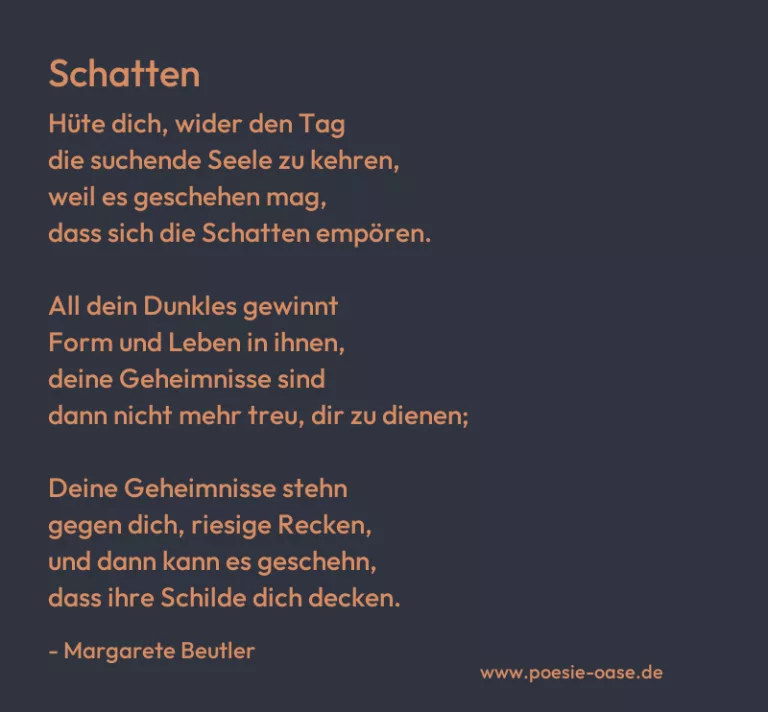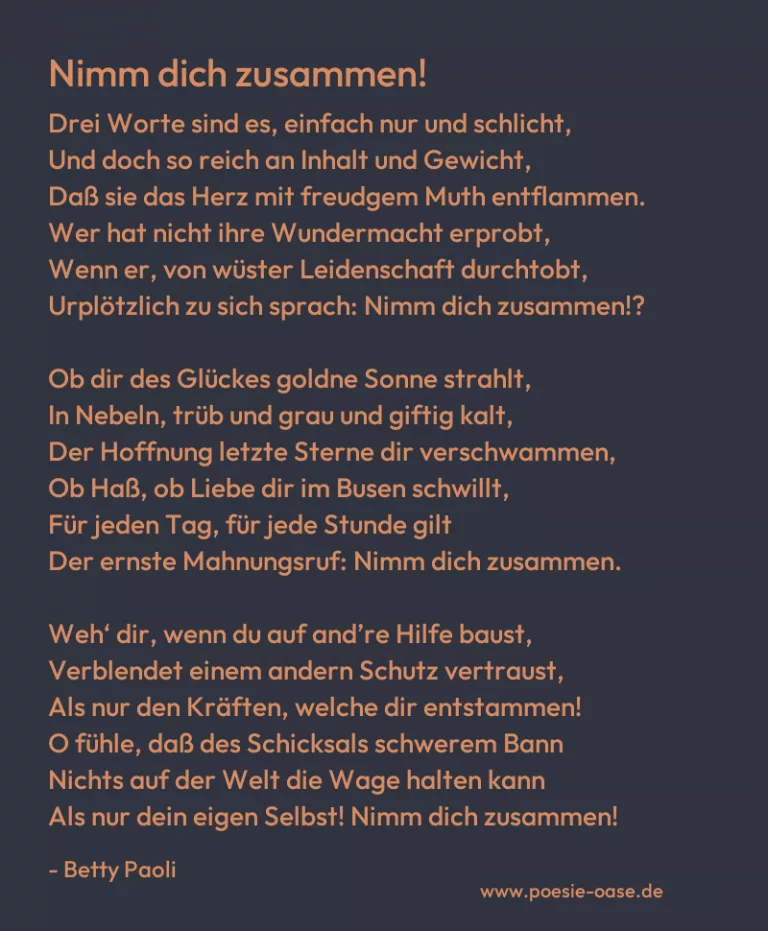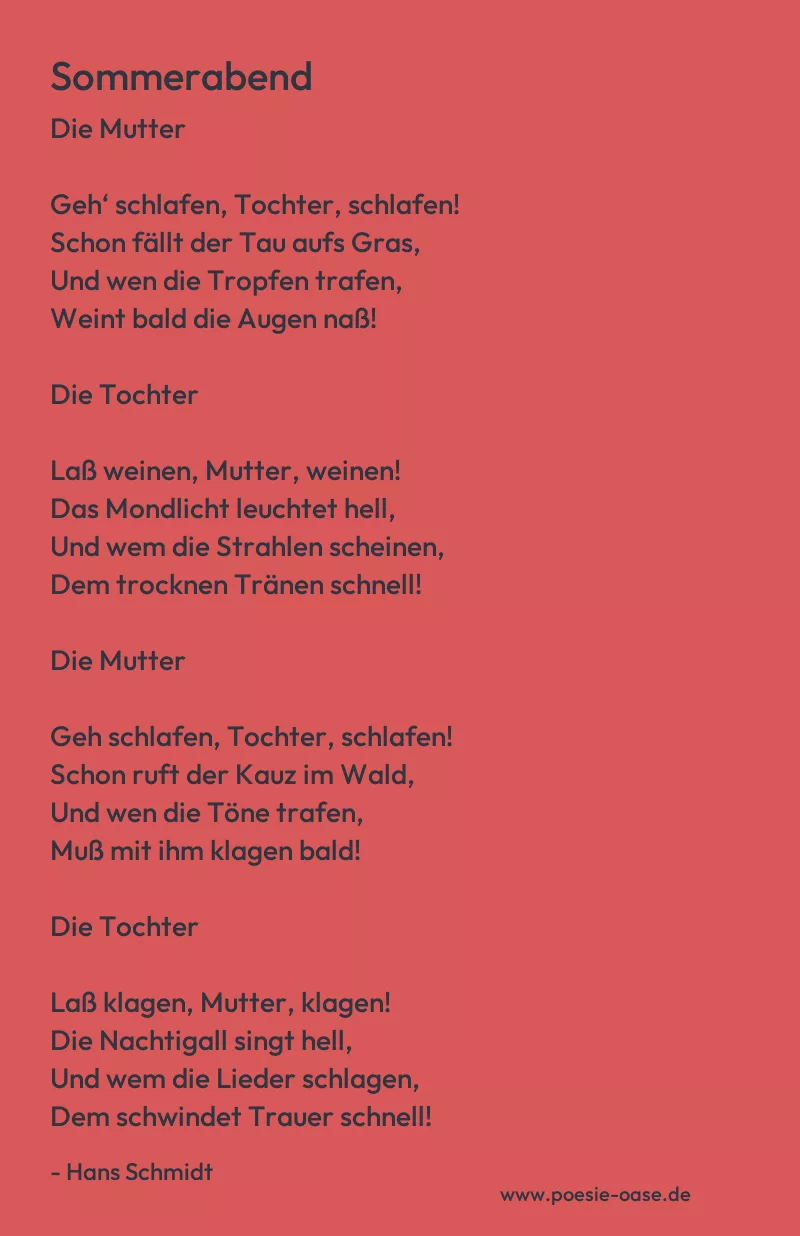Sommerabend
Die Mutter
Geh‘ schlafen, Tochter, schlafen!
Schon fällt der Tau aufs Gras,
Und wen die Tropfen trafen,
Weint bald die Augen naß!
Die Tochter
Laß weinen, Mutter, weinen!
Das Mondlicht leuchtet hell,
Und wem die Strahlen scheinen,
Dem trocknen Tränen schnell!
Die Mutter
Geh schlafen, Tochter, schlafen!
Schon ruft der Kauz im Wald,
Und wen die Töne trafen,
Muß mit ihm klagen bald!
Die Tochter
Laß klagen, Mutter, klagen!
Die Nachtigall singt hell,
Und wem die Lieder schlagen,
Dem schwindet Trauer schnell!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
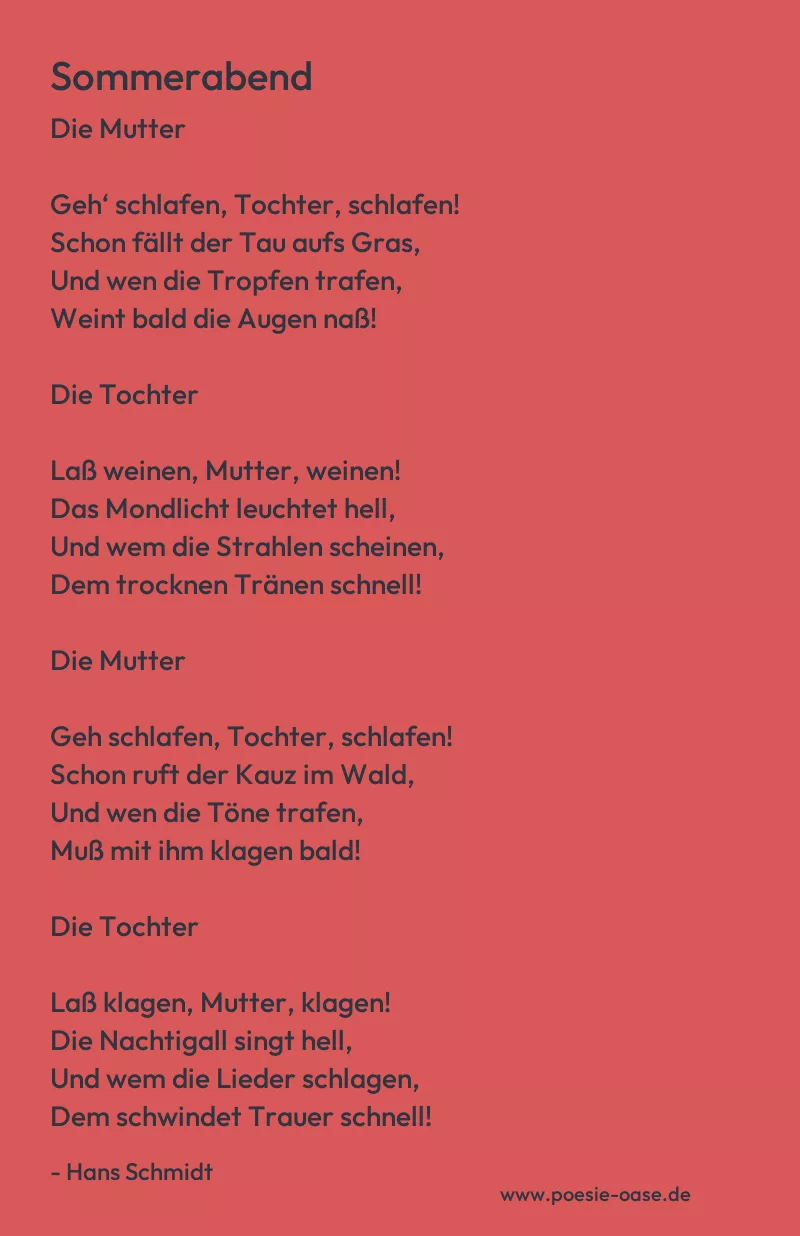
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sommerabend“ von Hans Schmidt zeichnet ein zartes Bild eines Dialogs zwischen einer Mutter und ihrer Tochter, das von Fürsorge und Trost geprägt ist. Die Mutter fordert ihre Tochter immer wieder auf, zu schlafen, wobei sie die beruhigenden Elemente der Natur heranzieht, um ihre Tochter zu beruhigen und vor den Emotionen des Tages zu schützen. Der „Tau“, der „aufs Gras fällt“, und die „Tropfen“, die den Schmerz symbolisieren, dienen als Metaphern für die Vergänglichkeit von Trauer und Sorgen, die in der Nacht durch den sanften Rhythmus der Natur abgelöst werden sollen. Der Hinweis, dass „die Augen bald naß“ werden, vermittelt den Wunsch der Mutter, die Tochter vor zu viel Emotion und Erschöpfung zu bewahren.
In der Antwort der Tochter wird der Trost nicht in der Fürsorge der Mutter gesucht, sondern in der heilenden Kraft der Natur. Sie weist die Mutter an, das „Weinen“ zuzulassen, da „das Mondlicht leuchtet hell“. Das Mondlicht wird hier als Symbol für die beruhigende und heilende Wirkung der Nacht verwendet. Die Tochter glaubt, dass die „Strahlen“ des Mondes in der Lage sind, die Tränen zu trocknen und damit die Trauer zu lindern. Dies zeigt eine junge Perspektive, die die Schönheit und Kraft der Natur als ein Mittel sieht, um emotionalen Schmerz zu überwinden, statt ihn zu unterdrücken.
Die Mutter bleibt jedoch beharrlich und verweist erneut auf die Natur als eine Quelle der Beruhigung. Sie fordert die Tochter zum Schlafen auf, während sie den „Kauz im Wald“ zitiert, der eine unheilvolle Atmosphäre von Trauer und Klage schafft. Der Kauz, ein Vogel, der traditionell mit Unglück und der Nacht assoziiert wird, steht hier als Symbol für die düsteren, melancholischen Gedanken, die die Mutter ihrer Tochter ersparen möchte. Sie sieht das Klagen als eine unausweichliche Folge der Dunkelheit und will die Tochter vor diesen düsteren Gedanken bewahren.
Die Tochter jedoch bleibt unbeeindruckt und entgegnet, dass sie das „Klagen“ der Mutter lassen möchte, da „die Nachtigall singt hell“. Für sie ist die Nachtigall, die traditionell für ihre schönen, melodischen Lieder bekannt ist, ein Symbol für Freude und Trost. In ihrer Antwort auf die Mutter zeigt die Tochter eine optimistische Haltung: Die „Lieder“ der Nachtigall vertreiben die „Trauer“, was den Glauben an die heilende Kraft der positiven Aspekte der Nacht unterstreicht. Sie vertraut darauf, dass die Musik der Nachtigall die Dunkelheit und die Sorgen vertreibt, im Gegensatz zur düsteren Vorstellung der Mutter.
Insgesamt ist das Gedicht eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf Trauer und Trost. Während die Mutter eine eher vorsichtige und schützende Haltung einnimmt, die den Schmerz abwenden möchte, akzeptiert die Tochter die Trauer als Teil des Lebens und vertraut auf die heilende und befreiende Wirkung der Natur. Diese Gegensätze spiegeln sich in den Bildern von Mondlicht, Kauz und Nachtigall wider, die jeweils unterschiedliche Perspektiven auf die Dunkelheit und den Trost der Nacht bieten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.