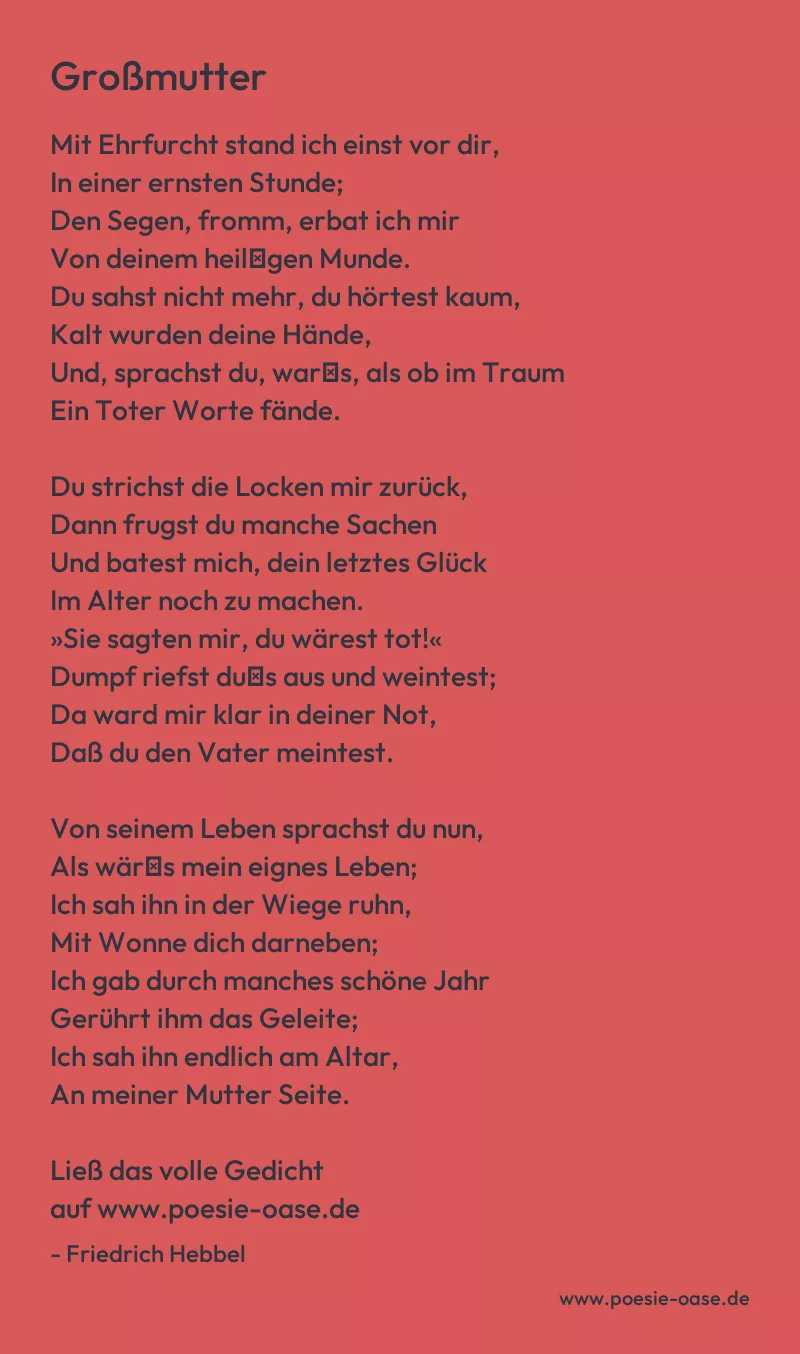Mit Ehrfurcht stand ich einst vor dir,
In einer ernsten Stunde;
Den Segen, fromm, erbat ich mir
Von deinem heil′gen Munde.
Du sahst nicht mehr, du hörtest kaum,
Kalt wurden deine Hände,
Und, sprachst du, war′s, als ob im Traum
Ein Toter Worte fände.
Du strichst die Locken mir zurück,
Dann frugst du manche Sachen
Und batest mich, dein letztes Glück
Im Alter noch zu machen.
»Sie sagten mir, du wärest tot!«
Dumpf riefst du′s aus und weintest;
Da ward mir klar in deiner Not,
Daß du den Vater meintest.
Von seinem Leben sprachst du nun,
Als wär′s mein eignes Leben;
Ich sah ihn in der Wiege ruhn,
Mit Wonne dich darneben;
Ich gab durch manches schöne Jahr
Gerührt ihm das Geleite;
Ich sah ihn endlich am Altar,
An meiner Mutter Seite.
Manch schlichtes Glück erfreute ihn,
Ich wurde ihm geboren;
Mein Bruder dann; jetzt aber schien
Der Faden dir verloren.
Du stocktest plötzlich, brachest ab
Und frugst, was nun gekommen,
Ich dachte an sein frühes Grab,
Doch schwieg ich, tief beklommen.
Du schluchztest, aufgetaut und weich,
Als hättst du nichts vergessen,
Und doch begannest du zugleich,
Von einer Frucht zu essen.
Den Stuhl zum Ofen schobst du dann,
Dich wieder einsam wähnend,
Und fingest laut zu beten an,
Dein Haupt vorüber lehnend.
Ich aber sah von fern die Zeit
Auch mein schon dunkel harren,
Wo mir die Welt nichts weiter beut,
Als Gräber aufzuscharren,
Und, weil dem schlotternden Gebein
Sich noch versagt das Bette,
Ich, selbst verglüht, in Gottes Sein
Mich still hinüber rette.