Hier ruht die Jungfrau Emma Puck aus Hinterstallupeinen,
Eine Mutter hatte sie eine, einen Vater hatte sie keinen.
In Unschuld erwuchs sie auf dem Land wie eine Lilie.
Da kam sie in die Stadt zu einer Rechnungsratsfamilie.
Hier hat sich erst ihr wahres Herz gezeigt,
Indem sie gar nicht mehr zur Jungfrau hingeneigt.
Bald kam das erste Kind. Was half da alles Greinen!
Männer hatte sie viel, aber einen Mann hatte sie keinen.
Grabschrift für eine Jungfrau
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
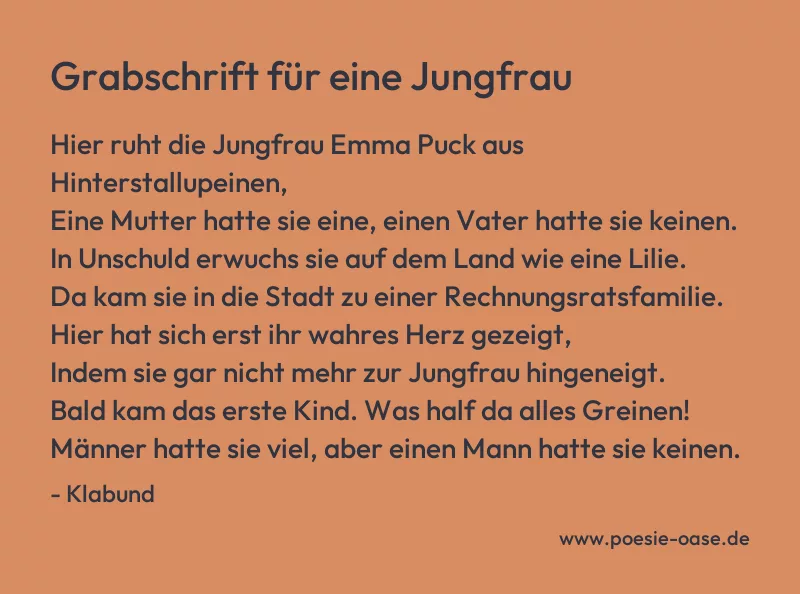
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Grabschrift für eine Jungfrau“ von Klabund ist eine sarkastische Abrechnung mit den gesellschaftlichen Konventionen und der Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft, verpackt in einer scheinbar schlichten Grabinschrift. Der Titel selbst ist bereits ironisch, da die Lebensgeschichte der Jungfrau Emma Puck weit entfernt von dem Ideal einer unschuldigen Jungfrau entfernt ist, wie es in einer Grabinschrift erwartet würde. Die ersten beiden Zeilen etablieren die äußeren Umstände ihres Lebens, mit dem Hinweis auf eine Mutter und das Fehlen eines Vaters, was bereits einen leichten Hauch von Außergewöhnlichkeit andeutet.
Der Kontrast zwischen Emmas idyllischer Kindheit auf dem Land, wo sie „wie eine Lilie“ aufwächst, und ihrer späteren Ankunft in der Stadt, wo sie in eine „Rechnungsratsfamilie“ gerät, ist von entscheidender Bedeutung. Diese Veränderung markiert den Übergang von Unschuld und Reinheit zur Korruption durch die soziale Umgebung. Die Ironie entfaltet sich in den darauffolgenden Versen, in denen Emmas wahre Natur zum Vorschein kommt – ein Herz, das sich „gar nicht mehr zur Jungfrau hingeneigt“. Diese Beschreibung deutet auf eine sexuelle Befreiung und ein Abweichen von den gesellschaftlichen Normen hin. Die „Greinen“ nach der Geburt des ersten Kindes, das aus einer unehelichen Beziehung stammt, zeigt die Konsequenzen ihrer Handlungen, aber auch eine gewisse Resignation.
Der Höhepunkt der Ironie liegt in den letzten beiden Versen. Emma Puck hatte „viel Männer“, doch „einen Mann hatte sie keinen“. Diese Zeile fasst ihr Leben prägnant zusammen und spielt mit dem Begriff „Mann“ in seiner doppelten Bedeutung. Sie hatte viele sexuelle Partner, aber keine dauerhafte, eheliche Bindung, was in der damaligen Gesellschaft als sozialer Makel galt. Klabund prangert mit dieser Zeile die Doppelmoral an, indem er die unterschiedliche Bewertung von männlichem und weiblichem sexuellem Verhalten thematisiert. Männer wurden oft für ihre sexuellen Eskapaden entschuldigt, während Frauen für ähnliches Verhalten verurteilt wurden.
Die Sprache des Gedichts ist einfach und volksliedhaft, was einen weiteren ironischen Effekt erzielt. Der scheinbar schlichte Stil verstärkt die Wirkung der kritischen Botschaft. Durch die Verwendung von Reimen und einer klaren Struktur wird die Geschichte leicht zugänglich, wodurch die Botschaft einer breiteren Leserschaft vermittelt werden kann. Klabund nutzt die Grabschrift als literarisches Mittel, um die scheinheilige Fassade der bürgerlichen Gesellschaft zu entlarven und die Scheinheiligkeit, die dem Bild der vermeintlichen Tugend anhaftet, bloßzustellen. Das Gedicht ist somit eine Satire auf eine Gesellschaft, die Doppelmoral und soziale Ungerechtigkeit begünstigt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
