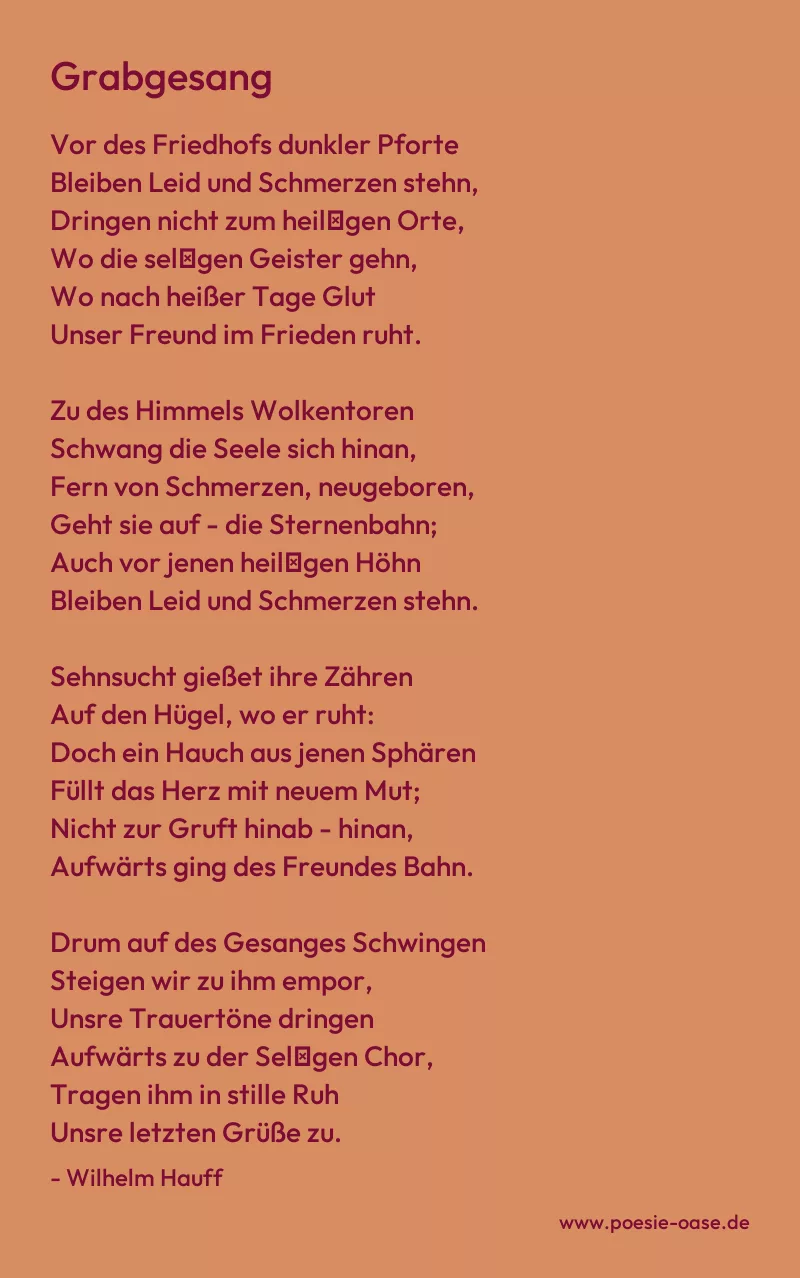Grabgesang
Vor des Friedhofs dunkler Pforte
Bleiben Leid und Schmerzen stehn,
Dringen nicht zum heil′gen Orte,
Wo die sel′gen Geister gehn,
Wo nach heißer Tage Glut
Unser Freund im Frieden ruht.
Zu des Himmels Wolkentoren
Schwang die Seele sich hinan,
Fern von Schmerzen, neugeboren,
Geht sie auf – die Sternenbahn;
Auch vor jenen heil′gen Höhn
Bleiben Leid und Schmerzen stehn.
Sehnsucht gießet ihre Zähren
Auf den Hügel, wo er ruht:
Doch ein Hauch aus jenen Sphären
Füllt das Herz mit neuem Mut;
Nicht zur Gruft hinab – hinan,
Aufwärts ging des Freundes Bahn.
Drum auf des Gesanges Schwingen
Steigen wir zu ihm empor,
Unsre Trauertöne dringen
Aufwärts zu der Sel′gen Chor,
Tragen ihm in stille Ruh
Unsre letzten Grüße zu.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
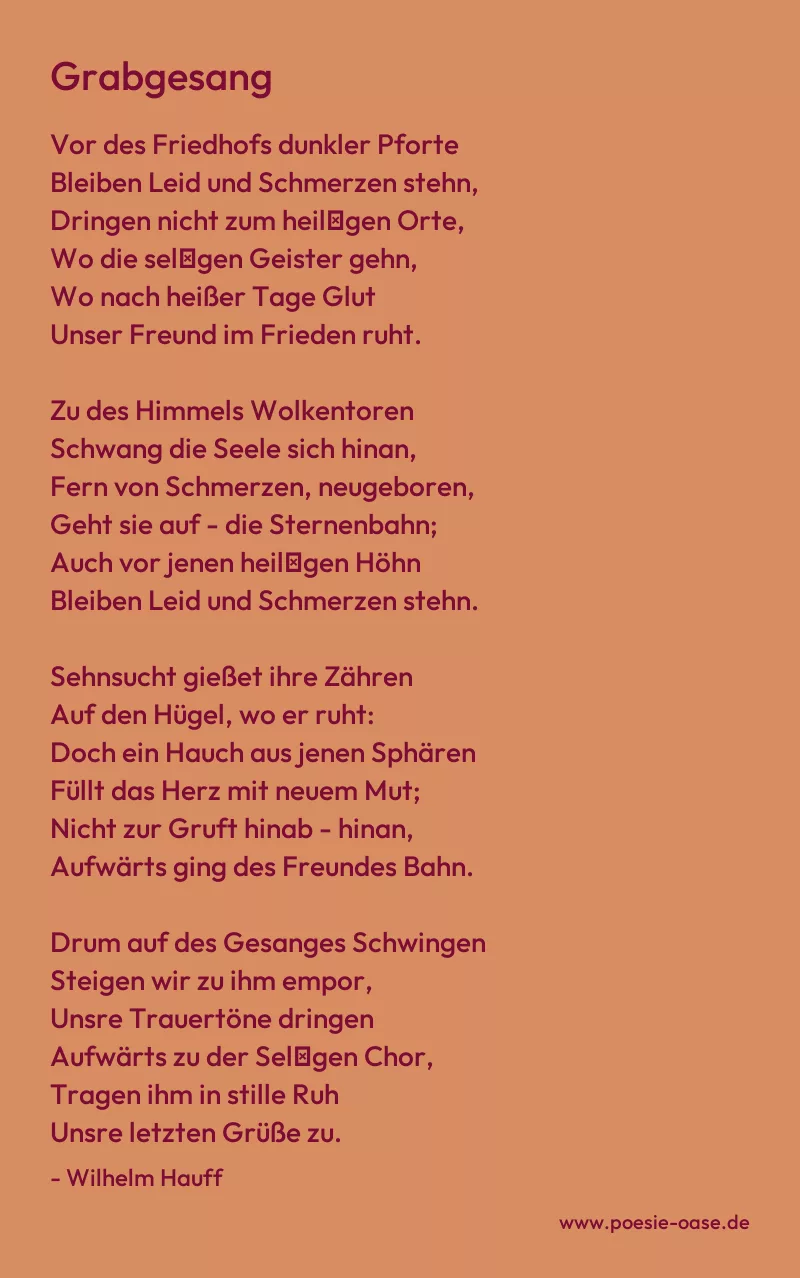
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Grabgesang“ von Wilhelm Hauff ist eine tröstende Elegie, die sich mit dem Tod und der Trauer auseinandersetzt, jedoch eine optimistische Perspektive einnimmt. Das Gedicht versucht, den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen zu mildern, indem es Trost in der Vorstellung eines Weiterlebens in einer himmlischen Sphäre sucht. Die Struktur des Gedichts, die in drei Strophen unterteilt ist, spiegelt den Weg der Seele des Verstorbenen wider – von der irdischen Welt bis in den Himmel.
Die ersten beiden Strophen beschreiben den Übergang von der Welt der Trauer und des Schmerzes in eine Sphäre der Ruhe und des Friedens. Die „Leid und Schmerzen“ bleiben „vor des Friedhofs dunkler Pforte“ und „vor jenen heil’gen Höhn“ stehen, was symbolisch für die Befreiung der Seele von irdischen Leiden steht. Der Verstorbene wird als jemand dargestellt, der in den „heil’gen Ort“ oder „zu des Himmels Wolkentoren“ aufsteigt. Die Metapher der „Sternenbahn“ deutet auf eine Reise in eine unendliche, überirdische Welt hin. Die zentrale Botschaft ist hier, dass der Tod nicht das Ende, sondern ein Übergang zu einem Zustand der Freiheit und des Friedens darstellt.
Die dritte Strophe wendet sich an die Trauernden selbst. Hier wird die Sehnsucht der Zurückgebliebenen angesprochen, die Tränen vergießen. Aber anstatt in der Verzweiflung zu verharren, wird eine neue Perspektive aufgezeigt. Ein „Hauch aus jenen Sphären“ erfüllt das Herz mit neuem Mut. Diese Zeilen evozieren die Idee, dass der Verstorbene nicht verloren ist, sondern in einer höheren, besseren Welt existiert und dass eine Verbindung durch die Liebe und Erinnerung weiterhin möglich ist. Die letzte Strophe hebt die Bedeutung der Erinnerung und der Hoffnung hervor, indem sie die Trauer in einen Gesang verwandelt, der sich zum Verstorbenen erhebt, um ihm letzte Grüße zu übermitteln.
Hauff verwendet eine einfache, gefühlvolle Sprache, die dem Thema angemessen ist. Die Reime und die regelmäßige Strophenstruktur verleihen dem Gedicht einen sanften, melodischen Fluss, der dazu beiträgt, die tröstliche Botschaft zu verstärken. Das Gedicht ist frei von komplizierten Bildern oder Metaphern, wodurch es für den Leser unmittelbar zugänglich und verständlich wird. Die zentralen Motive sind die Trennung durch den Tod, die Trauer, die Hoffnung und die Erwartung eines ewigen Lebens. Die Botschaft des Gedichts ist eine der Hoffnung und des Trostes: Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Übergang in eine Welt des Friedens, und die Verbindung zu den Verstorbenen bleibt durch die Erinnerung und die Liebe bestehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.