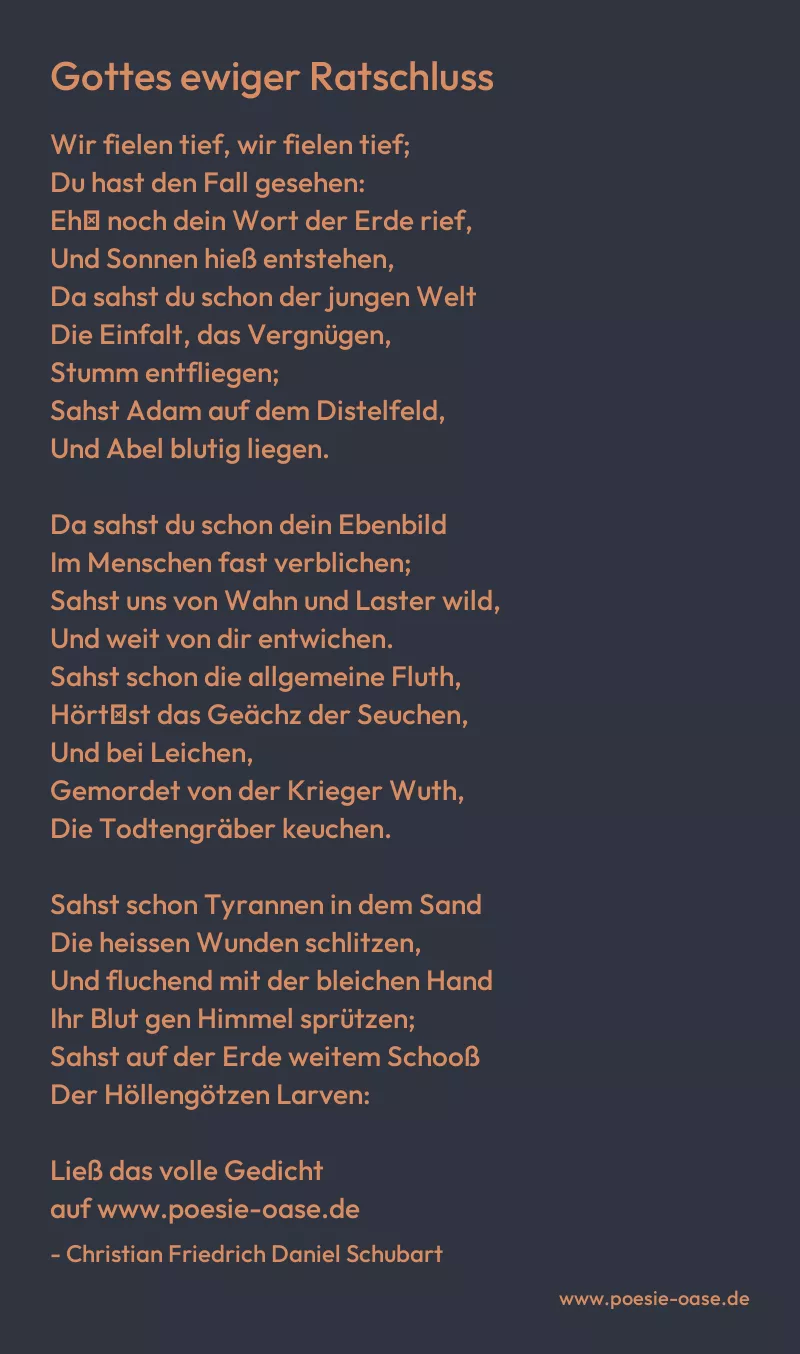Wir fielen tief, wir fielen tief;
Du hast den Fall gesehen:
Eh′ noch dein Wort der Erde rief,
Und Sonnen hieß entstehen,
Da sahst du schon der jungen Welt
Die Einfalt, das Vergnügen,
Stumm entfliegen;
Sahst Adam auf dem Distelfeld,
Und Abel blutig liegen.
Da sahst du schon dein Ebenbild
Im Menschen fast verblichen;
Sahst uns von Wahn und Laster wild,
Und weit von dir entwichen.
Sahst schon die allgemeine Fluth,
Hört′st das Geächz der Seuchen,
Und bei Leichen,
Gemordet von der Krieger Wuth,
Die Todtengräber keuchen.
Sahst schon Tyrannen in dem Sand
Die heissen Wunden schlitzen,
Und fluchend mit der bleichen Hand
Ihr Blut gen Himmel sprützen;
Sahst auf der Erde weitem Schooß
Der Höllengötzen Larven:
Dich verwarfen
Die Deinen, Blut des Säuglings floß
Beim Schall entweihter Harfen.
Sahst unter wilder Lüste Schwarm
Erstickte Menschenseelen,
Und, ach! verscheuchter Frommen Harm
In dumpfen Felsenhöhlen:
Hört′st Wuthgebrüll und Angstgeschrey,
Und aus verruchten Rachen
Spötter lachen;
Sahst Ehrsucht, Golddurst, Heuchelei,
Die Welt zur Hölle machen.
Auch sahst du, Gott! den vollen Strom
Des Bluts der Zeugen fliessen;
Sahst schon Jerusalem und Rom
Den Mord der Frommen büßen.
Doch, ach! wer deckt den Jammer auf,
Den du von deinen Höhen,
Gott! gesehen?
Wer kennt des Wahns und Lasters Lauf,
Und zählt der Erden Wehen?
Was solltest du, Weltrichter, thun?
Die Sünderwelt zerstäuben?
Die Frevler all′ mit ihrem Thun
In Höllennächte treiben?
Du nahmst die Wag′; es blitzten schon
Von fürchterlichen Strahlen
Ihre Schalen:
Schon wägst du der Empörer Lohn,
Vernichtung oder Qualen.
Doch, eh′ die Schal′ Entscheidung zückt,
So stand der Sohn am Throne,
Mit Blicken, wie die Liebe blickt,
Und sprach: O Vater! schone.
Ich will das Lamm zum Opfer seyn,
Will bluten für Verbrecher.
Schone, Rächer!
Und schenke mir, dem Bürgen, ein,
Den zorngefüllten Becher.
Da nahmst du, Gott! den Bürgen an.
Mit Mienen, hell von Gnade,
Sahst du von ferne Kanaan
Und deines Sohnes Pfade,
Gethsemane und Golgatha,
Mit Opferblut beflossen.
Ausgegossen
Wie Wasser, hing der Mittler da,
In Dunkel eingeschlossen.
Da hörtest du: »Es ist vollbracht!«
Herauf vom Hügel tönen;
Nun fühltest du der Liebe Macht,
Und liessest dich versöhnen.
Gott ist die Liebe! jauchzt die Schaar
Der Geister, stark im Meere;
Ihre Heere,
Sie sangen dir, der ist und war,
Und dem Erwürgten Ehre.
Gott ist die Liebe, Jesus ist
Die Liebe; sing′s, o Sünder!
Der du so hoch begnadigt bist,
Und lehr′ es deine Kinder.
Er liebte dich von Ewigkeit;
Wir sollten ihn nicht lieben?
Den betrüben,
Der uns vom ew′gen Fluch befreit?
Nicht jede Tugend üben?
Ja, lieben lieben wollen wir
Dich ewig, Gott der Liebe!
Doch heilige, wir flehen dir,
Erst unsers Herzens Triebe!
Dann sey es, Gott! dir ganz geweiht,
Und ihm, des Weibes Samen!
Amen! Amen!
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Sey Ehre deinem Namen!