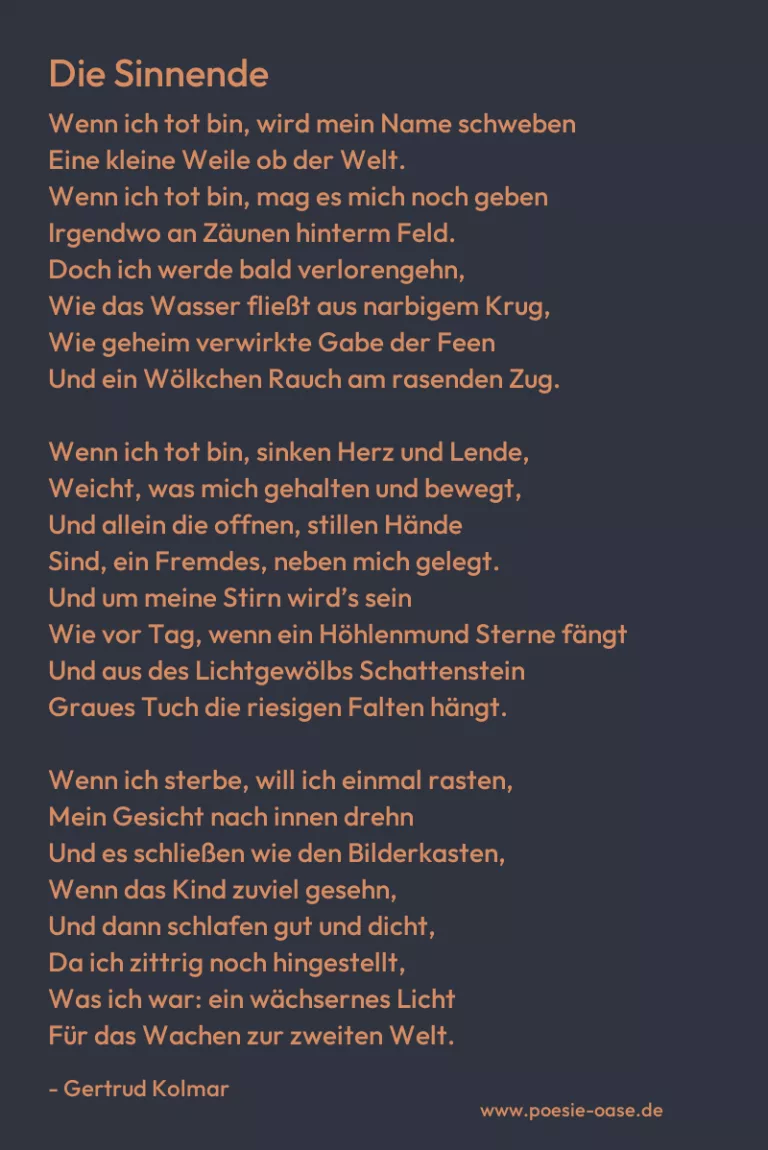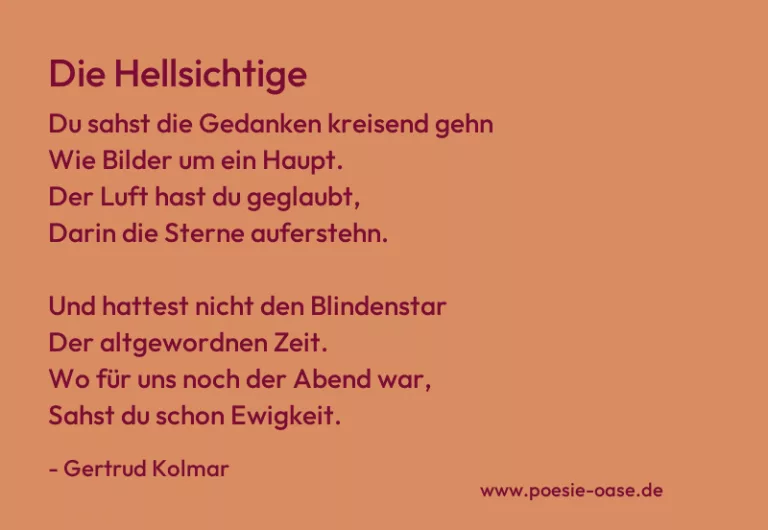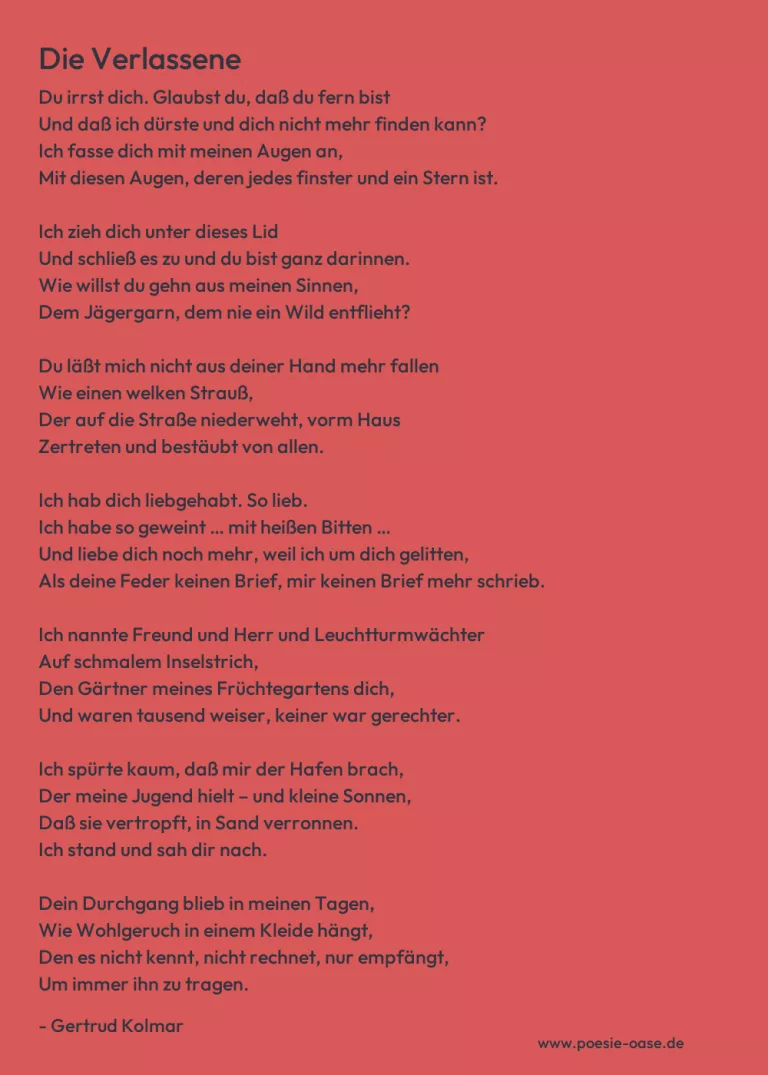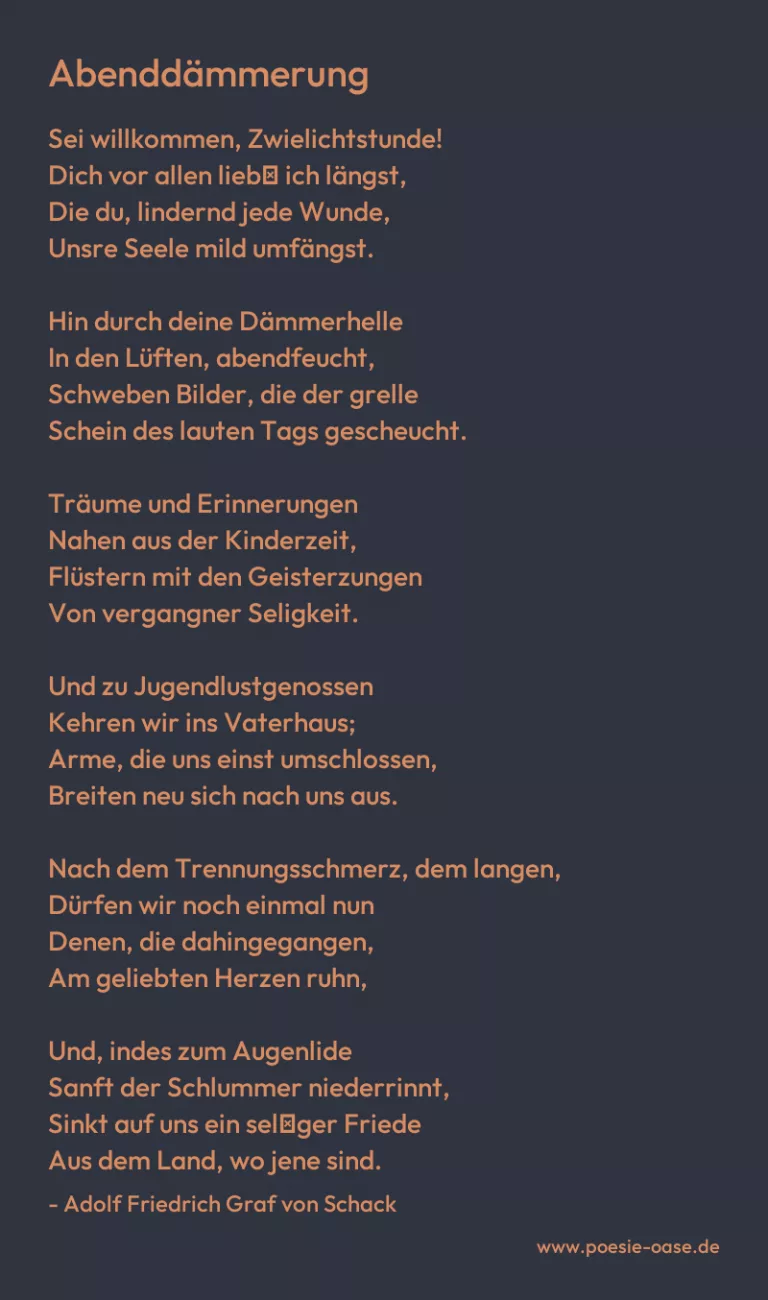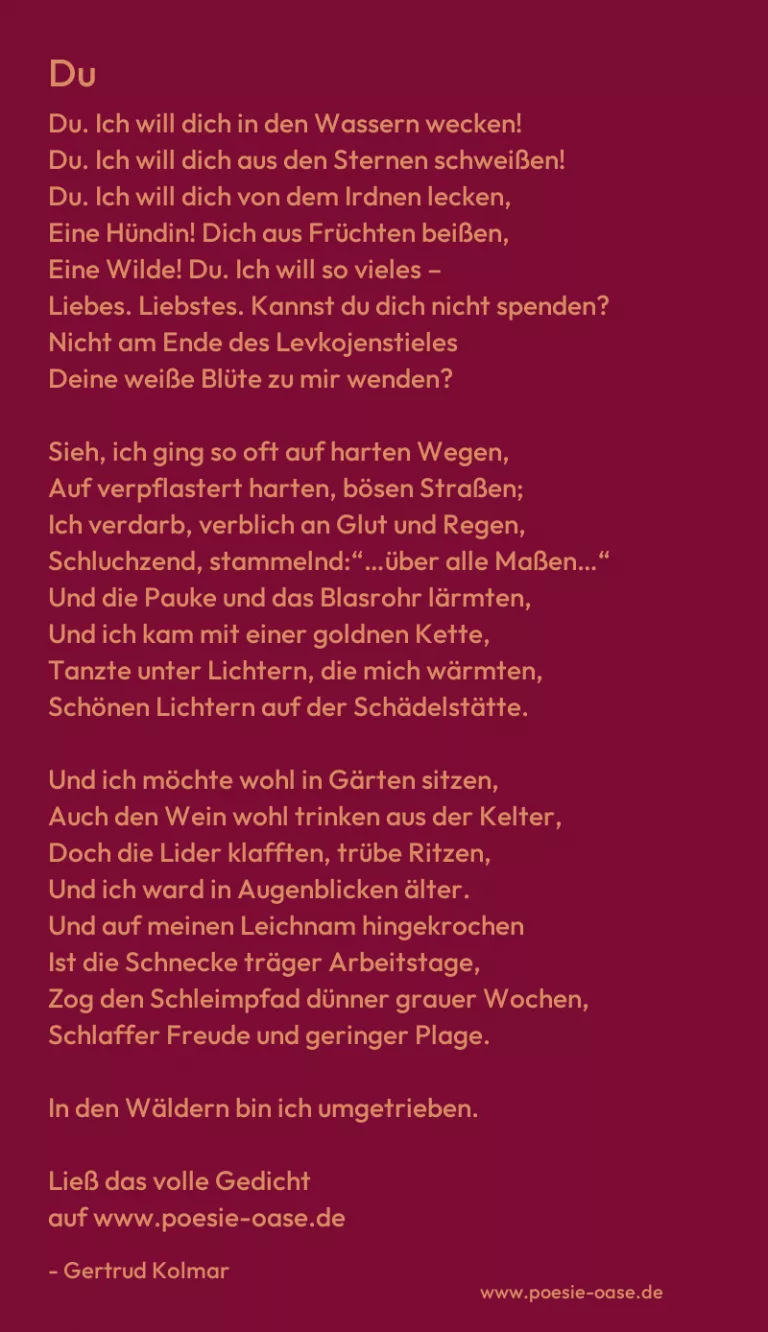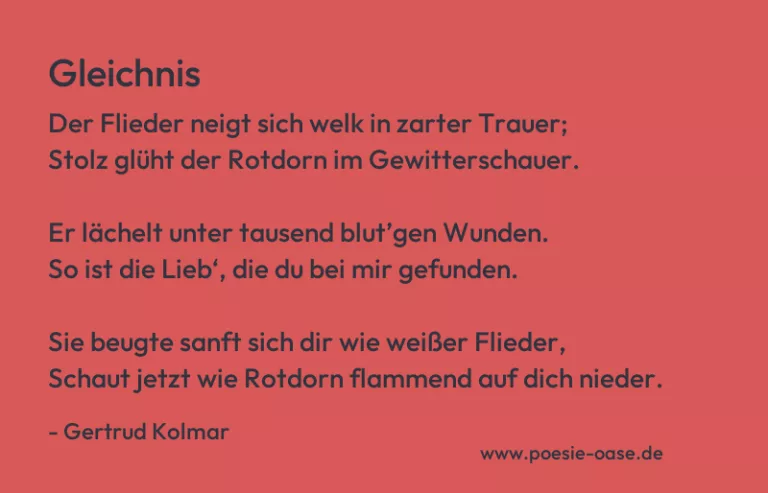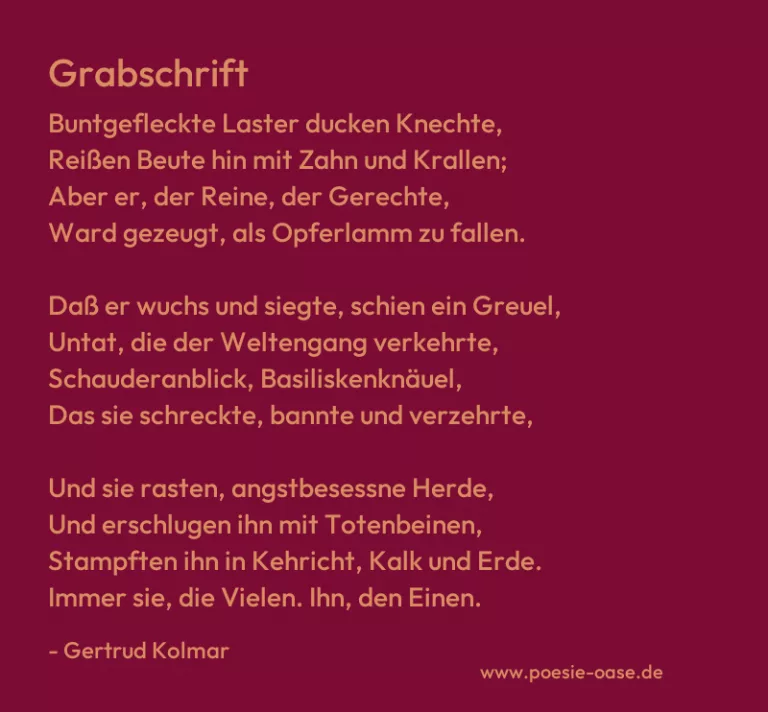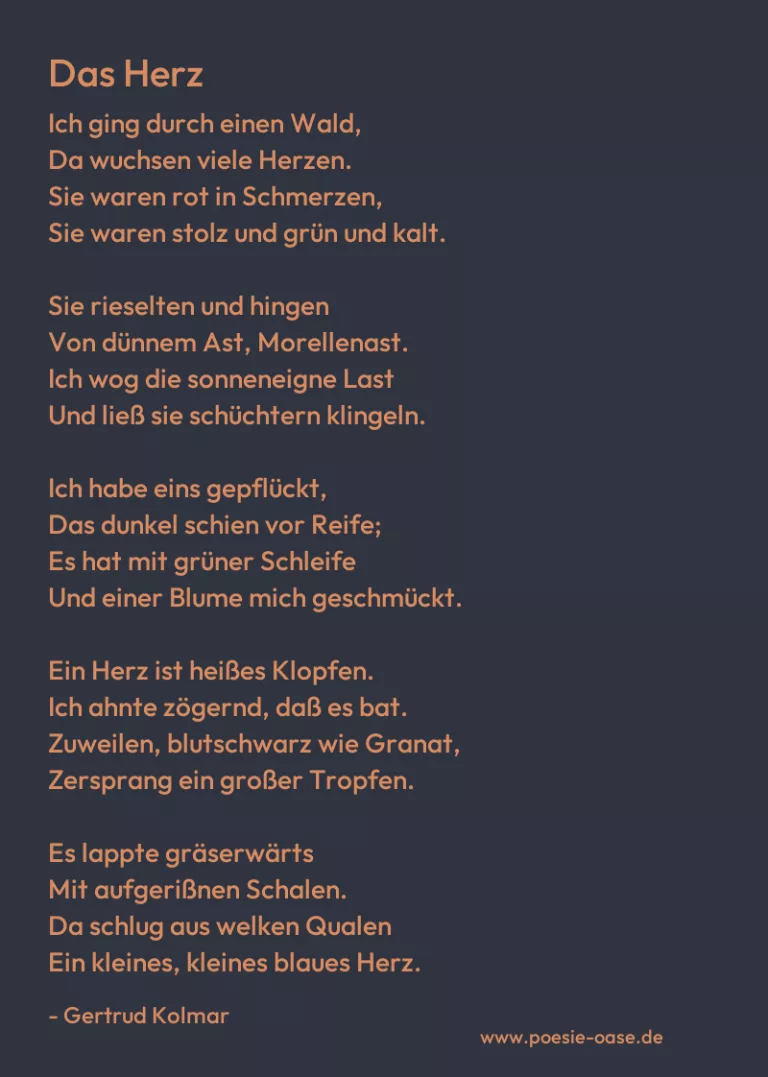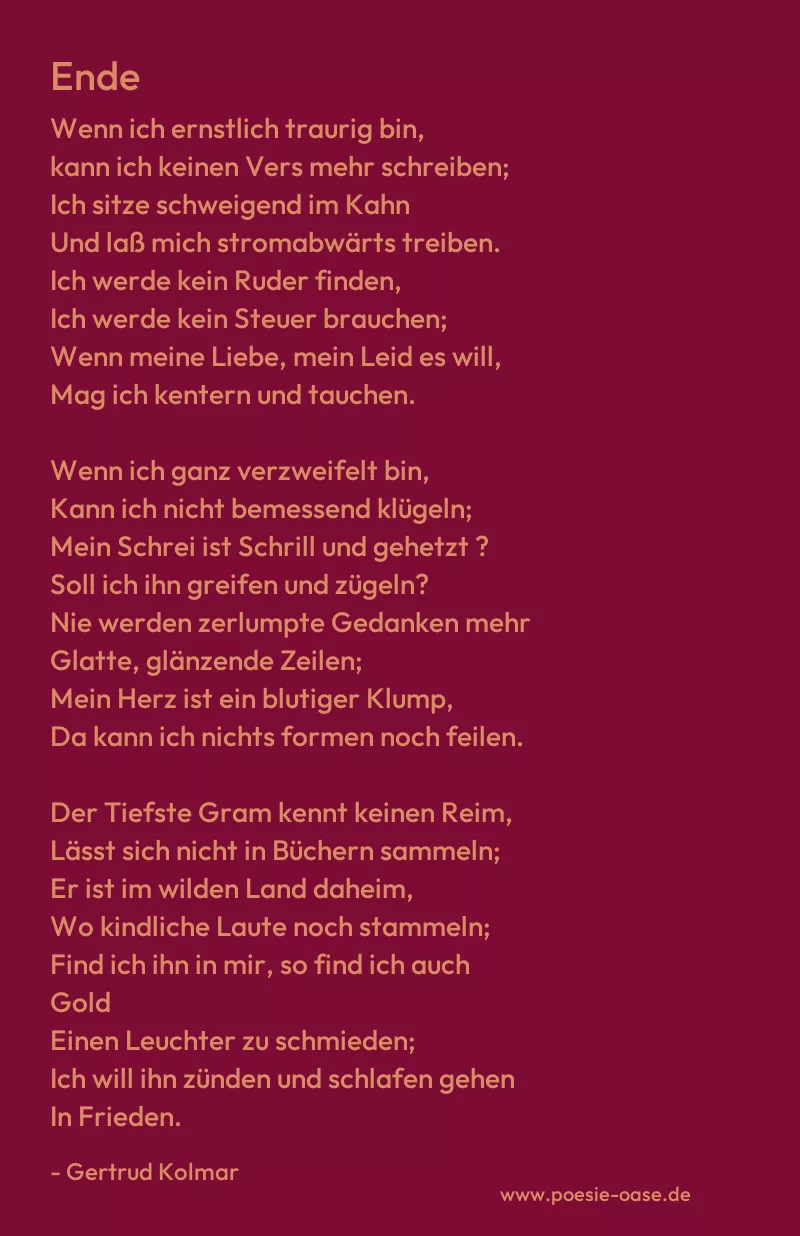Ende
Wenn ich ernstlich traurig bin,
kann ich keinen Vers mehr schreiben;
Ich sitze schweigend im Kahn
Und laß mich stromabwärts treiben.
Ich werde kein Ruder finden,
Ich werde kein Steuer brauchen;
Wenn meine Liebe, mein Leid es will,
Mag ich kentern und tauchen.
Wenn ich ganz verzweifelt bin,
Kann ich nicht bemessend klügeln;
Mein Schrei ist Schrill und gehetzt ?
Soll ich ihn greifen und zügeln?
Nie werden zerlumpte Gedanken mehr
Glatte, glänzende Zeilen;
Mein Herz ist ein blutiger Klump,
Da kann ich nichts formen noch feilen.
Der Tiefste Gram kennt keinen Reim,
Lässt sich nicht in Büchern sammeln;
Er ist im wilden Land daheim,
Wo kindliche Laute noch stammeln;
Find ich ihn in mir, so find ich auch
Gold
Einen Leuchter zu schmieden;
Ich will ihn zünden und schlafen gehen
In Frieden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
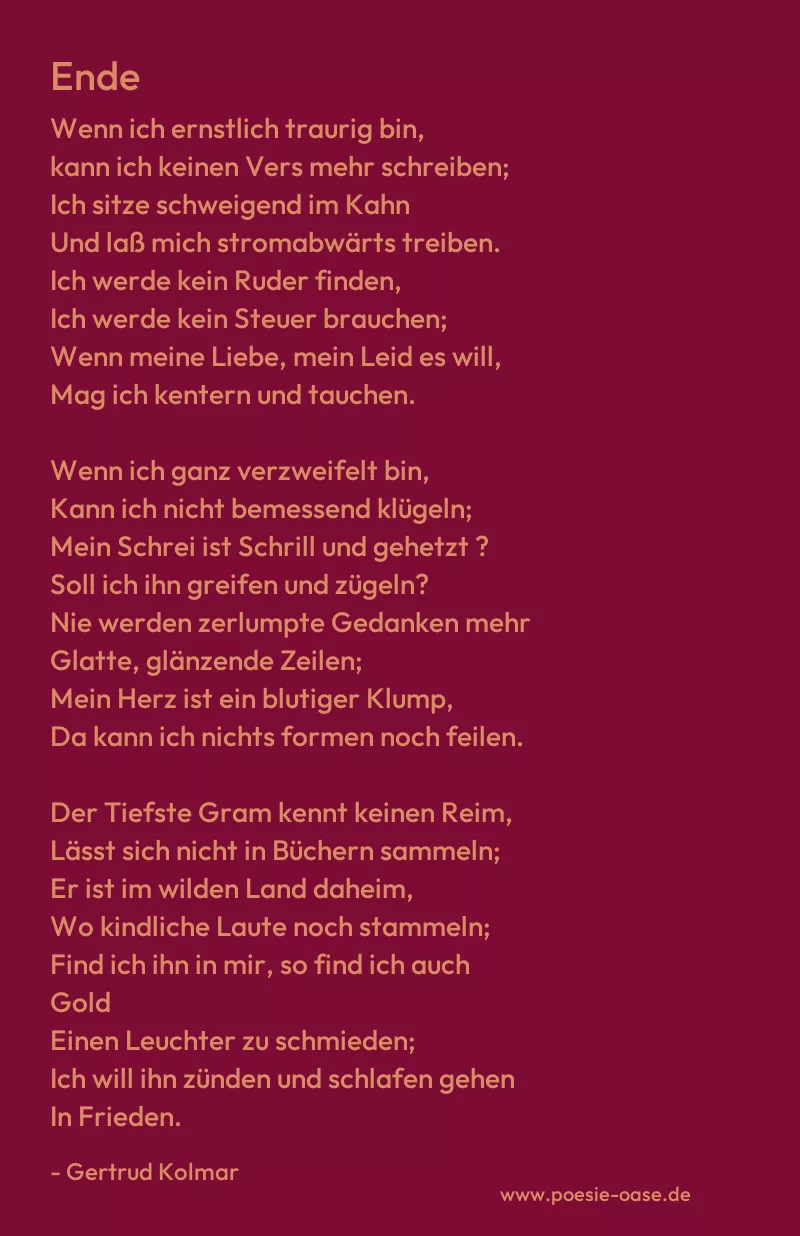
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ende“ von Gertrud Kolmar ist eine eindringliche Reflexion über den Zusammenhang von innerem Schmerz und dichterischem Ausdruck. In klarer, fast prosaischer Sprache beschreibt das lyrische Ich, wie tiefe Trauer und Verzweiflung das poetische Schaffen unmöglich machen – nicht aus Mangel an Gefühl, sondern weil das Gefühl zu roh, zu ungestaltet, zu überwältigend ist. Die Dichtung – sonst Mittel der Ordnung, der Gestaltung – versagt angesichts des „blutigen Klumps“ im Herzen.
Schon die erste Strophe zeigt dieses Bild der Resignation: Das lyrische Ich lässt sich treiben, wortlos, ohne Steuer oder Ruder. Es gibt sich der Strömung hin – ein starkes Bild für Kontrollverlust, für das Sich-Ausliefern an eine innere Bewegung, deren Richtung nicht mehr bewusst gelenkt werden kann. Die Liebe, das Leid – sie bestimmen den Kurs. Selbst ein Untergehen („kentern und tauchen“) wird nicht mehr als Widerstand, sondern als mögliches, fast friedliches Schicksal akzeptiert.
Die zweite Strophe führt diese Gedanken weiter: Verzweiflung macht Sprache unbeherrschbar. Der Versuch, sie zu „zügeln“, ist sinnlos. Gedanken sind „zerlumpt“, das Herz nicht mehr Quelle schöpferischer Form, sondern nur noch rohes, verletztes Material. Hier wird das Verhältnis von Gefühl und Form problematisiert – echte, tiefe Not sprengt die Möglichkeiten der Kunst, sie lässt sich nicht mehr „feilen“, nicht mehr ästhetisch fassen.
Doch gerade in dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit öffnet sich in der letzten Strophe ein neuer, fast mystischer Gedanke: Der „tiefste Gram“ ist nicht mehr reimbar, nicht sammelbar – er gehört in ein „wildes Land“, jenseits von Zivilisation und literarischer Ordnung. Dort, wo „kindliche Laute“ noch stammeln, liegt eine Wahrheit, die ursprünglicher, reiner ist als jeder Vers. Und doch: Wenn das Ich diesen Gram findet, findet es auch „Gold“ – die Möglichkeit, daraus einen „Leuchter“ zu schmieden, also ein Licht, ein Zeichen, eine letzte Form.
So endet das Gedicht in einem stillen Akt der Hoffnung: Der Leuchter wird gezündet – nicht für die Öffentlichkeit, nicht für ein Publikum, sondern für das eigene Einschlafen „in Frieden“. Das ist keine Flucht, sondern eine würdevolle Annahme der eigenen Grenzen. „Ende“ ist ein stilles, ehrliches Gedicht über die Grenzen der Sprache in der Verzweiflung – und zugleich ein Zeugnis dafür, wie genau darin eine neue, schlichte Form der Wahrheit entstehen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.