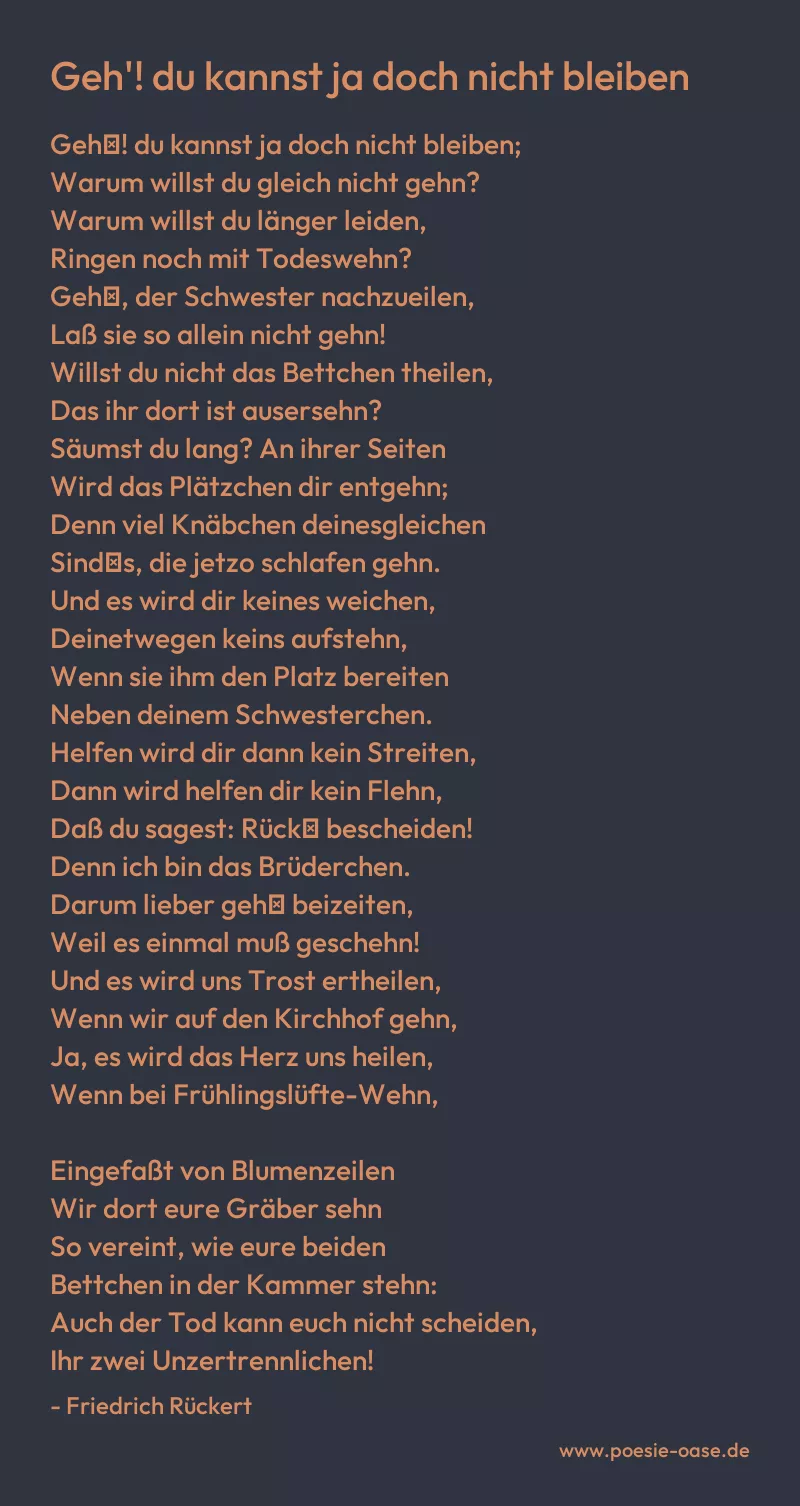Geh‘! du kannst ja doch nicht bleiben
Geh′! du kannst ja doch nicht bleiben;
Warum willst du gleich nicht gehn?
Warum willst du länger leiden,
Ringen noch mit Todeswehn?
Geh′, der Schwester nachzueilen,
Laß sie so allein nicht gehn!
Willst du nicht das Bettchen theilen,
Das ihr dort ist ausersehn?
Säumst du lang? An ihrer Seiten
Wird das Plätzchen dir entgehn;
Denn viel Knäbchen deinesgleichen
Sind′s, die jetzo schlafen gehn.
Und es wird dir keines weichen,
Deinetwegen keins aufstehn,
Wenn sie ihm den Platz bereiten
Neben deinem Schwesterchen.
Helfen wird dir dann kein Streiten,
Dann wird helfen dir kein Flehn,
Daß du sagest: Rück′ bescheiden!
Denn ich bin das Brüderchen.
Darum lieber geh′ beizeiten,
Weil es einmal muß geschehn!
Und es wird uns Trost ertheilen,
Wenn wir auf den Kirchhof gehn,
Ja, es wird das Herz uns heilen,
Wenn bei Frühlingslüfte-Wehn,
Eingefaßt von Blumenzeilen
Wir dort eure Gräber sehn
So vereint, wie eure beiden
Bettchen in der Kammer stehn:
Auch der Tod kann euch nicht scheiden,
Ihr zwei Unzertrennlichen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
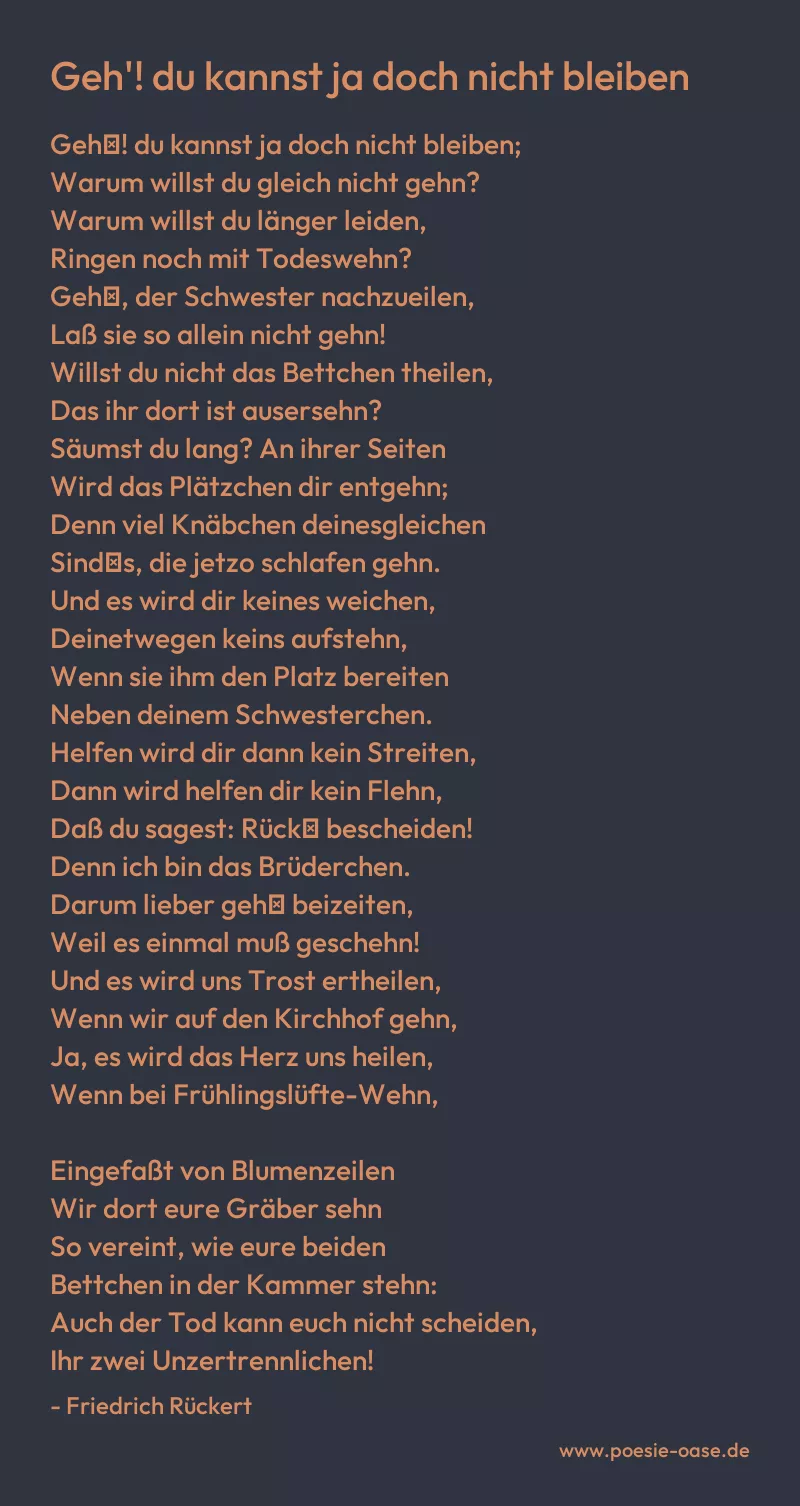
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Geh! du kannst ja doch nicht bleiben“ von Friedrich Rückert handelt von Abschied, Verlust und Trost angesichts des Todes eines Kindes. Es ist ein ergreifender Appell an den zurückbleibenden, vielleicht kranken oder sterbenden Bruder, sich dem Tod zu ergeben und der bereits verstorbenen Schwester in den Tod zu folgen. Rückert behandelt hier ein tiefes menschliches Leid auf eine Weise, die sowohl Trost spendet als auch die unausweichliche Realität des Sterbens thematisiert.
Die Struktur des Gedichts ist durch eine zarte Dialektik geprägt. Einerseits wird die Hoffnungslosigkeit des Bleibens thematisiert, die durch die wiederholte Aufforderung „Geh!“ betont wird. Der Sprecher argumentiert, dass das Kind ohnehin nicht genesen kann und das Leiden nur verlängert würde. Gleichzeitig wird die Nähe zur verstorbenen Schwester als unwiderrufliche und tröstliche Bindung dargestellt. Die Verweise auf das „Bettchen“ und die „Blumenzeilen“ am Grab suggerieren eine friedliche Vereinigung im Tod. Die sanfte Überredungskunst des Sprechers zielt darauf ab, dem Kind die Angst vor dem Sterben zu nehmen und es in den Schoß der Familie und der Liebe zurückzuführen, die im Tod vereint ist.
Die sprachliche Gestaltung des Gedichts ist von einer berührenden Einfachheit und Eindringlichkeit geprägt. Der wiederholte Imperativ „Geh!“ wirkt wie ein sanfter, aber bestimmter Aufruf. Rückert nutzt zudem eine klare und einfache Sprache, um die Botschaft verständlich zu machen. Die Verwendung von Bildern wie dem „Bettchen“ und den „Blumenzeilen“ erzeugt eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens, die den Schrecken des Todes mildern soll. Die Metaphern, die mit dem Frühling und der Vereinigung am Grab verknüpft sind, vermitteln Hoffnung und Trost inmitten des Verlustes.
Die letztendliche Botschaft des Gedichts liegt in der Akzeptanz des Todes als Teil des Lebens und in der Kraft der Liebe, die über den Tod hinaus bestehen bleibt. Die Zeilen, in denen von der Vereinigung am Grab die Rede ist, betonen die Unzertrennlichkeit der Geschwister und die tröstliche Gewissheit, dass auch der Tod diese Verbindung nicht aufheben kann. Rückert bietet somit keine einfache Antwort auf den Schmerz, sondern eine Perspektive, die Trost durch die Akzeptanz des Schicksals und die Erinnerung an die Liebe findet. Das Gedicht ist somit eine tiefgründige Reflexion über Trauer, Abschied und die transzendente Kraft der Liebe im Angesicht des Todes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.