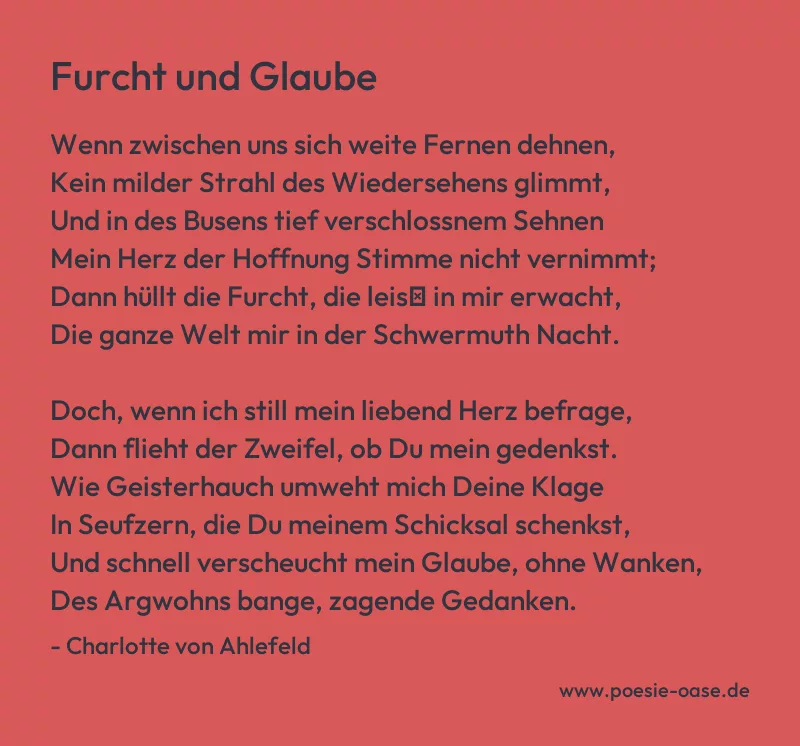Furcht und Glaube
Wenn zwischen uns sich weite Fernen dehnen,
Kein milder Strahl des Wiedersehens glimmt,
Und in des Busens tief verschlossnem Sehnen
Mein Herz der Hoffnung Stimme nicht vernimmt;
Dann hüllt die Furcht, die leis′ in mir erwacht,
Die ganze Welt mir in der Schwermuth Nacht.
Doch, wenn ich still mein liebend Herz befrage,
Dann flieht der Zweifel, ob Du mein gedenkst.
Wie Geisterhauch umweht mich Deine Klage
In Seufzern, die Du meinem Schicksal schenkst,
Und schnell verscheucht mein Glaube, ohne Wanken,
Des Argwohns bange, zagende Gedanken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
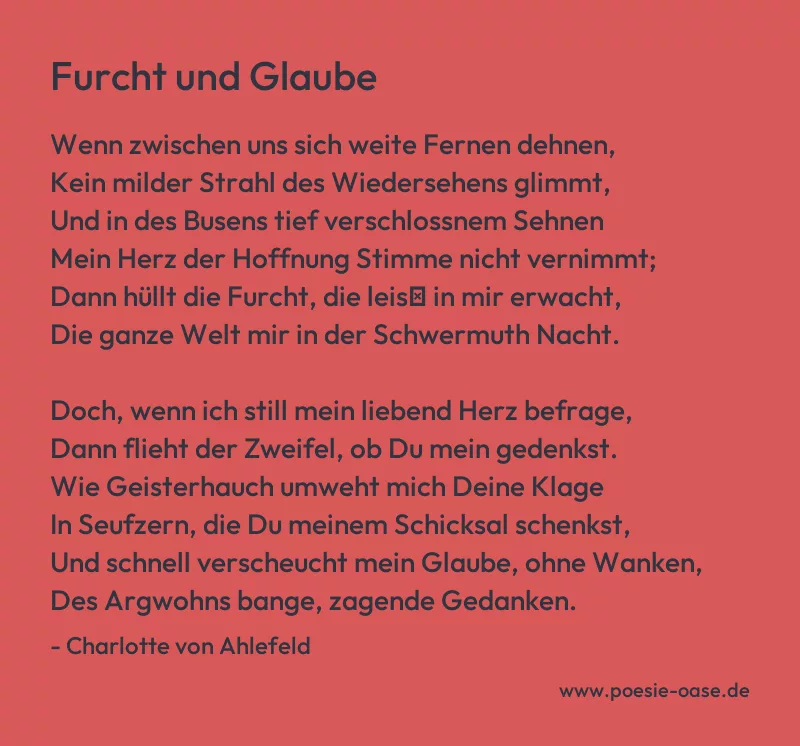
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Furcht und Glaube“ von Charlotte von Ahlefeld zeichnet ein eindringliches Bild des inneren Zwiespalts, der durch die Trennung von einer geliebten Person entsteht. Es thematisiert die Zerrissenheit zwischen der Angst vor dem Verlust und dem Glauben an die Fortdauer der Liebe. Im ersten Teil des Gedichts wird die Furcht als vorherrschendes Gefühl dargestellt, das die Welt in eine „Schwermuth Nacht“ hüllt, wenn die Distanz zwischen den Liebenden unüberwindbar scheint und die Hoffnung auf ein Wiedersehen schwindet.
Die Autorin beschreibt eindrücklich die Macht der Furcht, die durch die physische Trennung genährt wird. Die „weiten Fernen“, die sich ausdehnen, und das Fehlen eines „mild[en] Strahl[s] des Wiedersehens“ lassen die Hoffnung erlöschen. Diese äußeren Umstände wirken sich unmittelbar auf das innere Erleben aus, sodass die Furcht als düstere Macht die Welt in Dunkelheit taucht. Das Herz, gefangen in tiefem Sehnen, kann die Stimme der Hoffnung nicht mehr vernehmen, was die Verzweiflung und das Gefühl der Isolation noch verstärkt.
Im zweiten Teil vollzieht sich eine Wendung, indem der Glaube als Gegenpol zur Furcht in den Vordergrund tritt. Die Autorin wendet sich an ihr „liebend Herz“, um eine innere Befragung vorzunehmen. Durch diese Selbstreflexion flieht der Zweifel, der zuvor von der Furcht genährt wurde. Nun vernimmt sie die „Klage“ des Geliebten, die sie als „Geisterhauch“ wahrnimmt und als Zeichen der Verbundenheit interpretiert, selbst in der Trennung. Diese Verbindung wird durch die „Seufzer“ ausgedrückt, die dem Schicksal der Autorin geschenkt werden.
Die abschließenden Zeilen unterstreichen die Stärke des Glaubens. Der Glaube, ohne „Wanken“, verscheucht die „bange, zagende Gedanken“ des Argwohns. Dies verdeutlicht, dass die Liebe, trotz der Widrigkeiten, durch den Glauben an die Verbindung und die Gefühle des anderen überdauern kann. Ahlefeld zeigt hier, dass der Glaube an die Liebe, die wahre Stärke des Herzens ist, die selbst die tiefsten Ängste zu überwinden vermag. Das Gedicht ist somit ein Zeugnis der Hoffnung und der Kraft des menschlichen Geistes, der sich in der Liebe bewährt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.