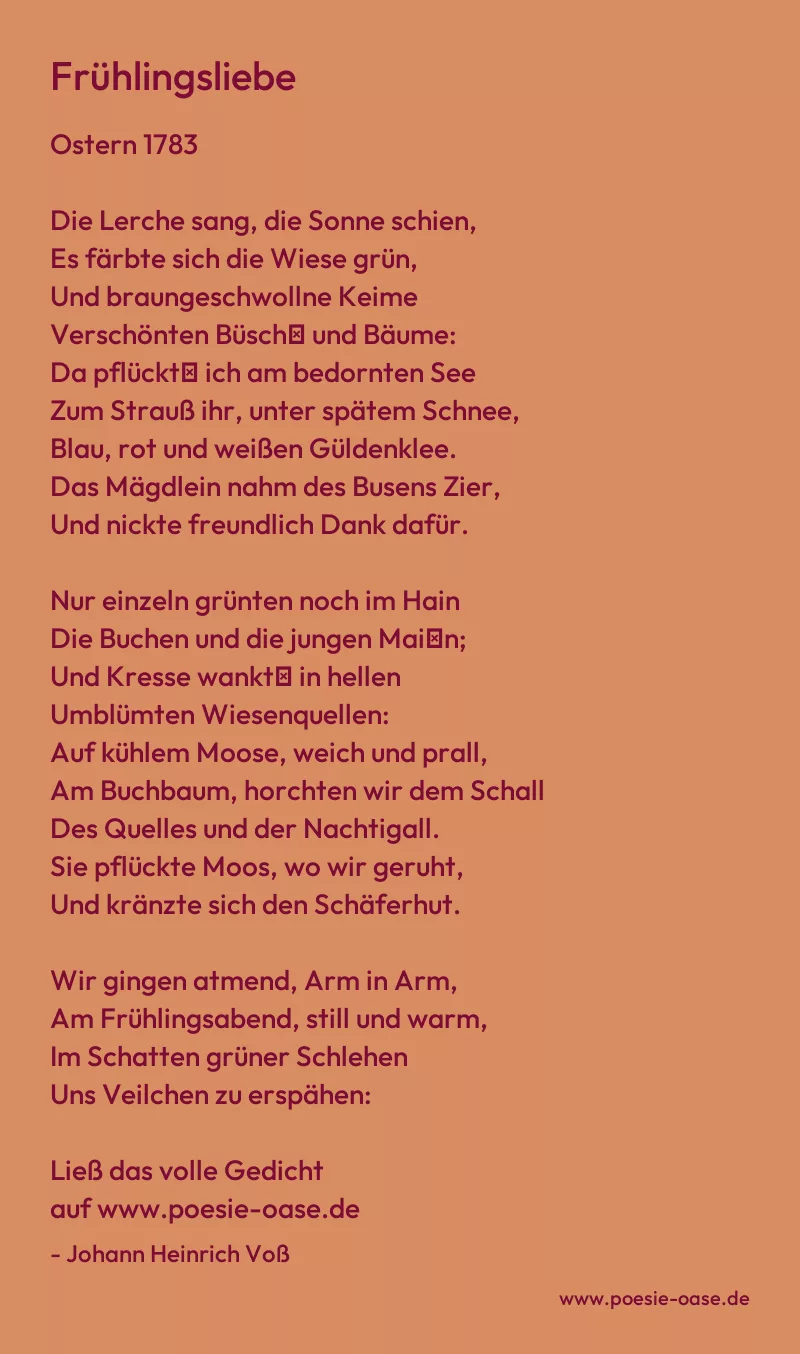Angst, Blumen & Pflanzen, Emotionen & Gefühle, Götter, Helden & Prinzessinnen, Himmel & Wolken, Natur, Ostern, Sommer, Wälder & Bäume, Weisheiten, Winter
Frühlingsliebe
Ostern 1783
Die Lerche sang, die Sonne schien,
Es färbte sich die Wiese grün,
Und braungeschwollne Keime
Verschönten Büsch′ und Bäume:
Da pflückt′ ich am bedornten See
Zum Strauß ihr, unter spätem Schnee,
Blau, rot und weißen Güldenklee.
Das Mägdlein nahm des Busens Zier,
Und nickte freundlich Dank dafür.
Nur einzeln grünten noch im Hain
Die Buchen und die jungen Mai′n;
Und Kresse wankt′ in hellen
Umblümten Wiesenquellen:
Auf kühlem Moose, weich und prall,
Am Buchbaum, horchten wir dem Schall
Des Quelles und der Nachtigall.
Sie pflückte Moos, wo wir geruht,
Und kränzte sich den Schäferhut.
Wir gingen atmend, Arm in Arm,
Am Frühlingsabend, still und warm,
Im Schatten grüner Schlehen
Uns Veilchen zu erspähen:
Rot schien der Himmel und das Meer;
Mit einmal strahlte, groß und hehr,
Der liebe volle Mond daher.
Das Mägdlein stand und ging und stand,
Und drückte sprachlos mir die Hand.
Rotwangicht, leichtgekleidet saß
Sie neben mir auf Klee und Gras,
Wo ringsum helle Blüten
Der Apfelbäume glühten:
Ich schwieg; das Zittern meiner Hand,
Und mein bethränter Blick gestand
Dem Mägdlein, was mein Herz empfand.
Sie schwieg, und aller Wonn′ Erguß
Durchströmt′ uns beid′ im ersten Kuß.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
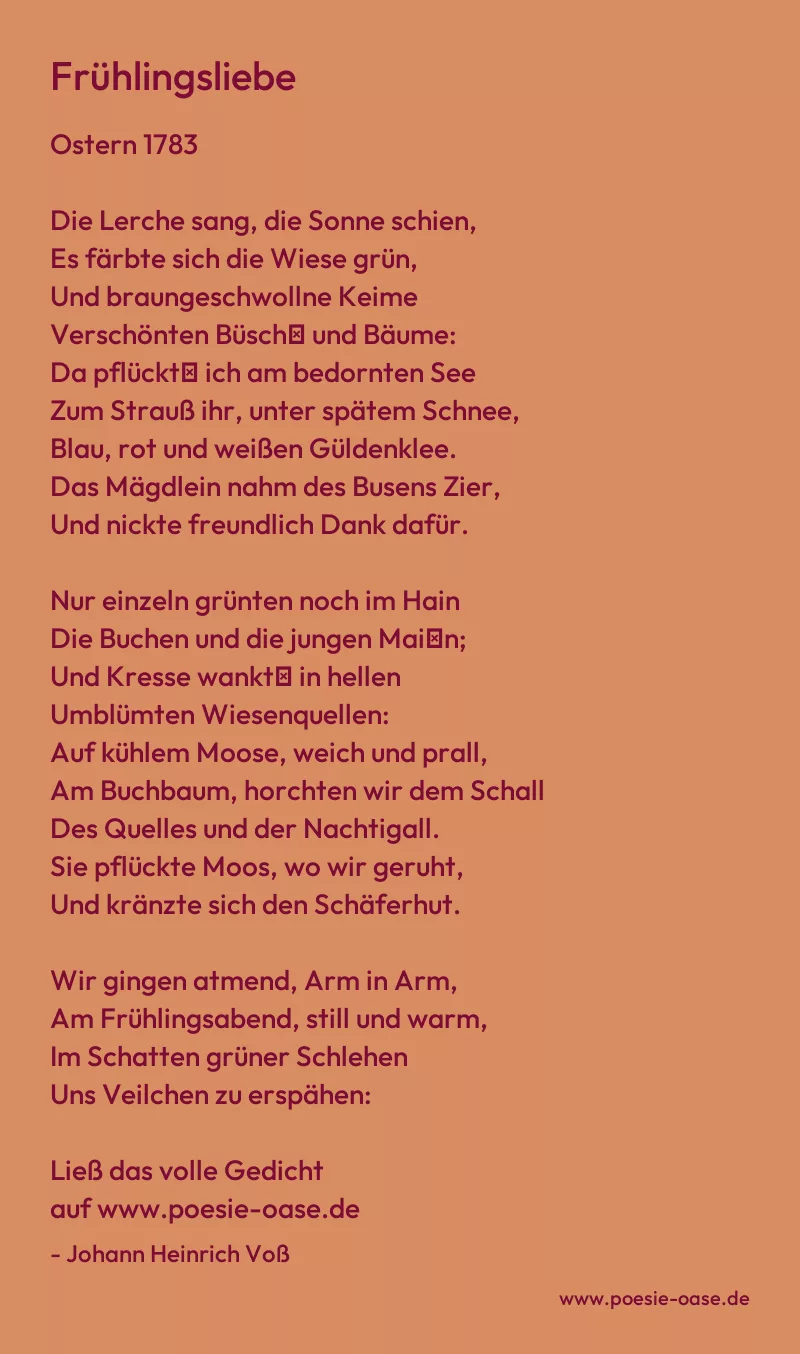
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Frühlingsliebe“ von Johann Heinrich Voß ist eine lyrische Darstellung einer aufblühenden Liebe, eingebettet in die Atmosphäre des Frühlings. Es beschreibt die Entwicklung einer romantischen Beziehung von den ersten zaghaften Zeichen der Zuneigung bis hin zum innigen Kuss, wobei die Natur als Spiegel und Verstärker der Gefühle dient. Die geschickte Verwendung von Bildern, Farben und Klängen der Natur, wie die singende Lerche, die grüne Wiese, der blaue und rote Klee, die Nachtigall und der Mond, erzeugt eine sinnliche und lebendige Atmosphäre, die die Leser in die Szenerie eintauchen lässt.
Das Gedicht ist in drei Strophen gegliedert, die jeweils verschiedene Phasen der Annäherung des lyrischen Ichs an das „Mägdlein“ widerspiegeln. Die erste Strophe beginnt mit der Beschreibung der erwachenden Natur im Frühling, in der das lyrische Ich einen Blumenstrauß pflückt, um ihn dem Mädchen zu schenken. Dieser Akt der Zuneigung wird durch das „freundliche“ Nicken des Mädchens erwidert, was bereits die Möglichkeit einer gegenseitigen Zuneigung andeutet. Die zweite Strophe verlagert die Szene in den Hain, wo das Paar die Naturgeräusche genießt und sich näherkommt. Die beschriebenen Aktivitäten wie das Hören des Quellens und der Nachtigall, sowie das Kränzen des Schäferhuts, unterstreichen die Vertrautheit und das harmonische Miteinander.
Die dritte Strophe markiert den Höhepunkt der Entwicklung der Liebe. Das Paar spaziert am Frühlingsabend und betrachtet den roten Himmel und das Meer, bevor der Mond erscheint. Die Anwesenheit des Mondes, ein Symbol für Romantik und Sehnsucht, verstärkt die emotionale Intensität. Die Szene gipfelt in der Beschreibung des ersten Kusses, der als ein überwältigendes Gefühl des Glücks dargestellt wird, das beide Liebenden ergreift. Das Mädchen, das rotwangig und leicht bekleidet auf dem Klee sitzt, gesteht schweigend ihre Gefühle. Diese Stille und der erste Kuss als Konsequenz der durch die Natur unterstützten Gefühle, symbolisieren das Erreichen des emotionalen Höhepunkts und das vollkommene Verständnis zwischen den Liebenden.
Voß verwendet eine einfache, aber ausdrucksstarke Sprache, die die Unmittelbarkeit der Erfahrung betont. Die klaren Beschreibungen der Natur, kombiniert mit den subtilen Gesten und Emotionen der Charaktere, schaffen ein eindringliches Bild der aufblühenden Liebe. Die Verwendung von Reimschema und rhythmischer Struktur verleiht dem Gedicht eine musikalische Qualität, die die Gefühle der Verliebtheit noch verstärkt. Insgesamt ist „Frühlingsliebe“ ein gelungenes Beispiel für die Romantik, die die Schönheit der Natur und die Intensität der menschlichen Emotionen feiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.