Schöner Stern
Hab‘ Dich gern,
Schau’st ins Fensterlein,
Und ins Herz hinein.
Schönste Zier
Strahle mir,
Bist so ganz allein,
Stolzes Sternelein.
Schöner Stern
Hab‘ Dich gern,
Schau’st ins Fensterlein,
Und ins Herz hinein.
Schönste Zier
Strahle mir,
Bist so ganz allein,
Stolzes Sternelein.
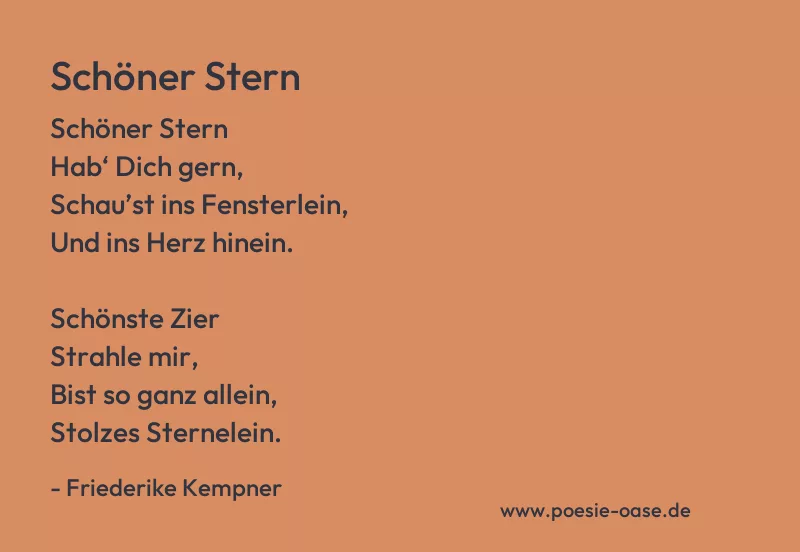
Das Gedicht „Schöner Stern“ von Friederike Kempner ist eine zarte, stimmungsvolle Miniatur, die in einfacher Sprache eine intime Verbindung zwischen dem lyrischen Ich und einem Himmelskörper herstellt. In wenigen Versen entfaltet sich eine poetische Zwiesprache, in der der Stern zum Gegenüber, ja fast zum Seelenverwandten wird.
Die ersten beiden Verse – „Schöner Stern / Hab’ Dich gern“ – eröffnen das Gedicht mit einer kindlich anmutenden Direktheit und Innigkeit. Die emotionale Zuneigung zum Stern wirkt spontan, fast verspielt. In der Folge wird deutlich, dass der Stern mehr ist als ein schönes Naturphänomen: Er schaut „ins Fensterlein / Und ins Herz hinein“. Damit wird er zu einem stillen Beobachter, zu einem Zeugen des Innersten, der sowohl physisch nah als auch emotional bedeutungsvoll ist.
Die zweite Strophe hebt die Schönheit und Einsamkeit des Sterns hervor. Als „schönste Zier“ strahlt er für das lyrische Ich, wird aber zugleich als „ganz allein“ beschrieben – ein „stolzes Sternelein“, das seine Erhabenheit und seine Einsamkeit gleichermaßen verkörpert. Diese Zuschreibung gibt dem Stern eine menschliche Dimension: Er ist schön, stolz, leuchtend, aber auch isoliert.
Kempner gelingt es, in diesen wenigen Zeilen eine Stimmung von nächtlicher Intimität, Sehnsucht und sanfter Melancholie zu schaffen. Der Stern steht dabei nicht nur für Schönheit, sondern auch für das stille Mitfühlen, das nicht urteilt, sondern nur da ist – eine leuchtende Konstante in der Dunkelheit, die sowohl tröstlich als auch einsam wirkt. Das Gedicht ist ein leiser, poetischer Blick in die Nacht – und ins eigene Herz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.