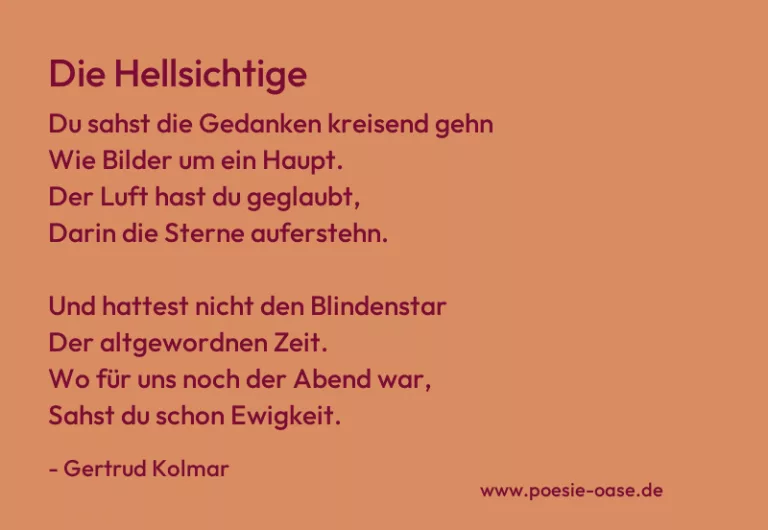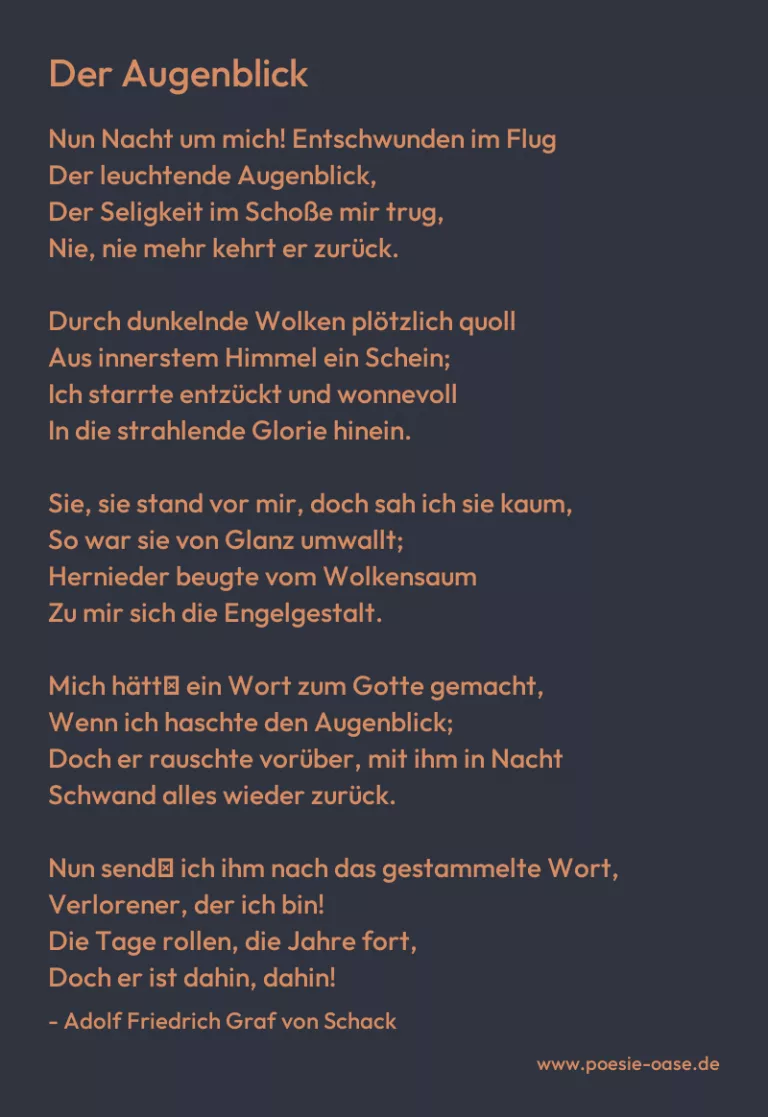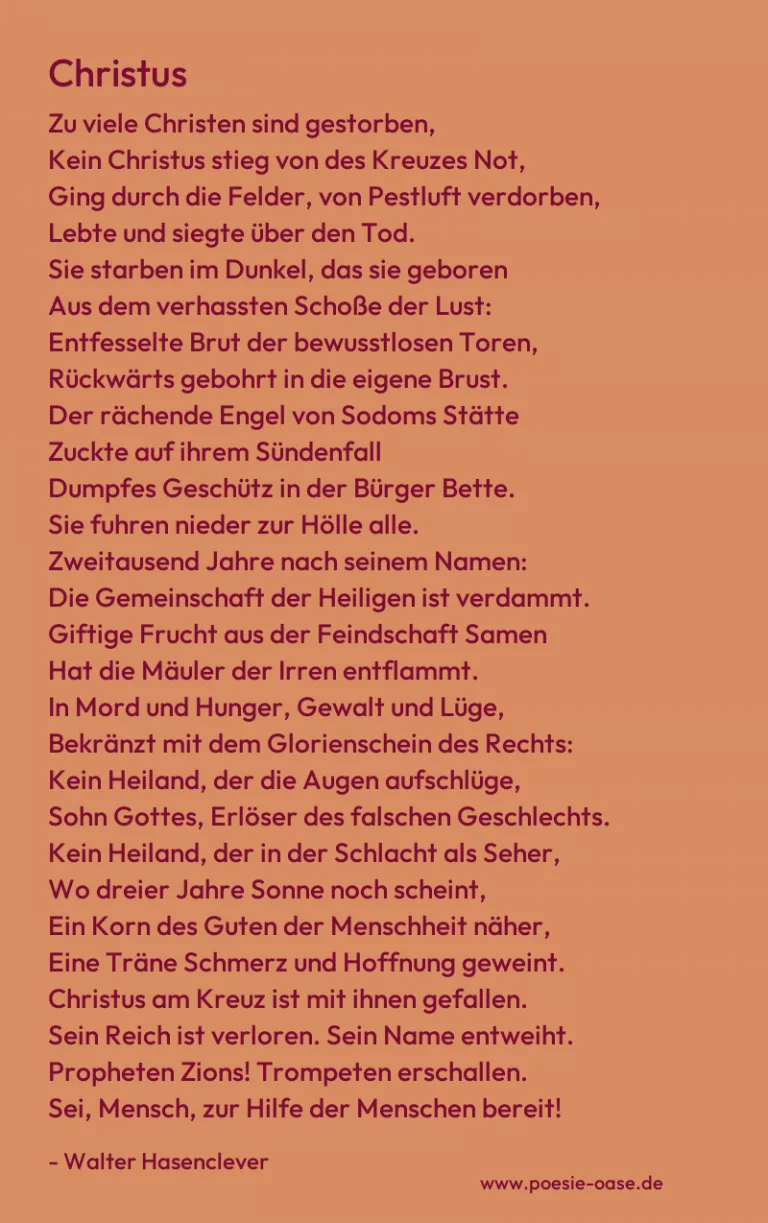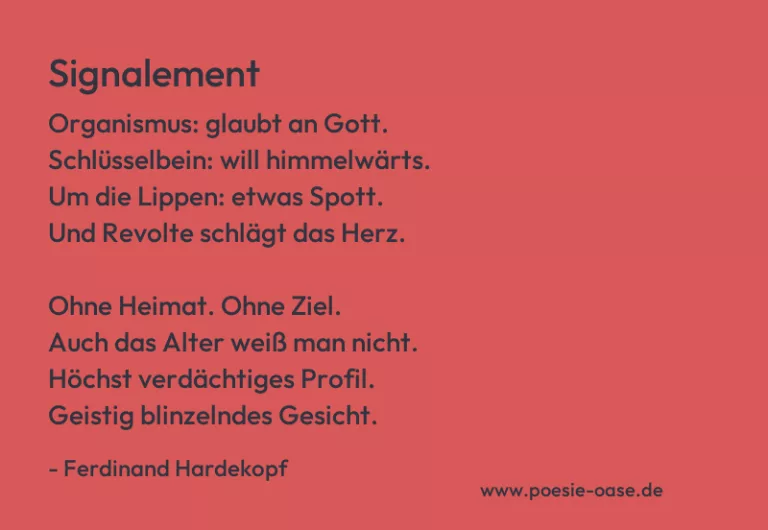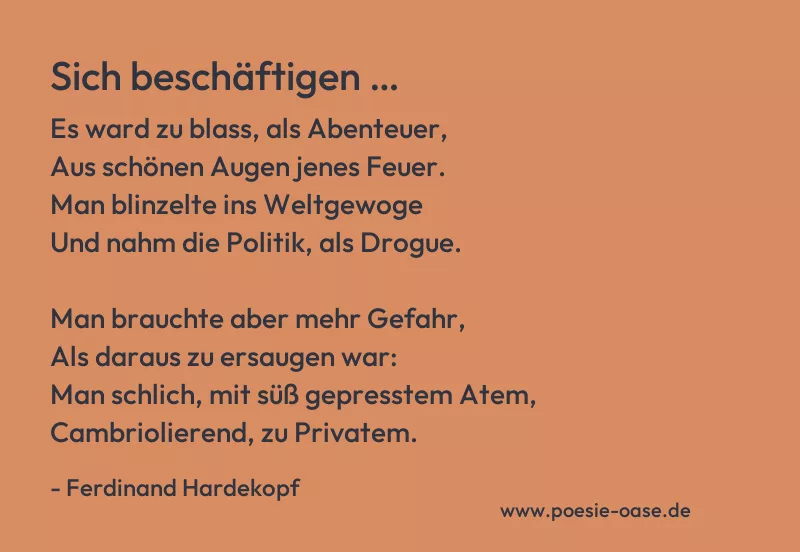Sich beschäftigen …
Es ward zu blass, als Abenteuer,
Aus schönen Augen jenes Feuer.
Man blinzelte ins Weltgewoge
Und nahm die Politik, als Drogue.
Man brauchte aber mehr Gefahr,
Als daraus zu ersaugen war:
Man schlich, mit süß gepresstem Atem,
Cambriolierend, zu Privatem.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
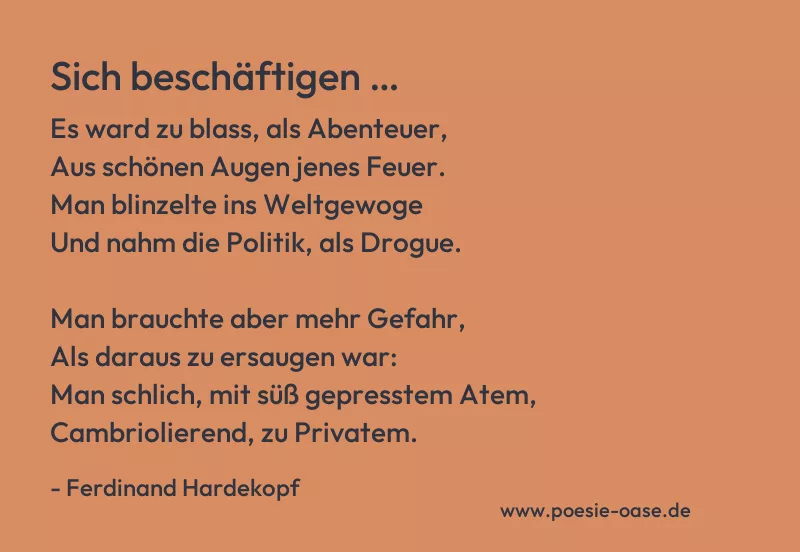
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sich beschäftigen …“ von Ferdinand Hardekopf thematisiert die Suche nach Nervenkitzel und Erregung in einer Welt, die ihre Faszination und Intensität verloren hat. In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich die Ernüchterung: Das „Feuer“ in den „schönen Augen“ ist „zu blass“ geworden, das Abenteuer hat an Reiz verloren. Statt echter Leidenschaft oder Erregung bleibt nur das „Weltgewoge“, das distanziert und blinzelnd wahrgenommen wird. Als Ersatz sucht man Ablenkung in der „Politik, als Drogue“ – eine ironische Bemerkung, die Politik als bloße Betäubung oder als stimulierendes Mittel abwertet.
In der zweiten Strophe verstärkt sich diese Rastlosigkeit. Die „Gefahr“, die man im politischen Geschehen sucht, reicht nicht aus, um die innere Leere zu füllen. Das Bedürfnis nach echter Aufregung und Risiko führt die Figur in den Bereich des Privaten – hier tritt das „Cambriolierend“ auf, also der Einbruch oder Diebstahl, der mit „süß gepresstem Atem“ vollzogen wird. Diese Wendung deutet auf die Flucht in kriminelle oder verbotene Handlungen als letztes Mittel gegen die innere Langeweile.
Hardekopf beschreibt eine von Dekadenz und Müdigkeit geprägte Welt, in der traditionelle Abenteuer und politische Beschäftigung keine echte Erfüllung mehr bieten. Das Gedicht spiegelt die Entfremdungserfahrung eines Menschen wider, der in einer überreizten Moderne nach neuen Formen der Erregung sucht und dabei moralische Grenzen überschreitet. Der Ton bleibt dabei kühl und ironisch, was die innere Leere und die resignierte Haltung der Figur noch stärker betont.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.