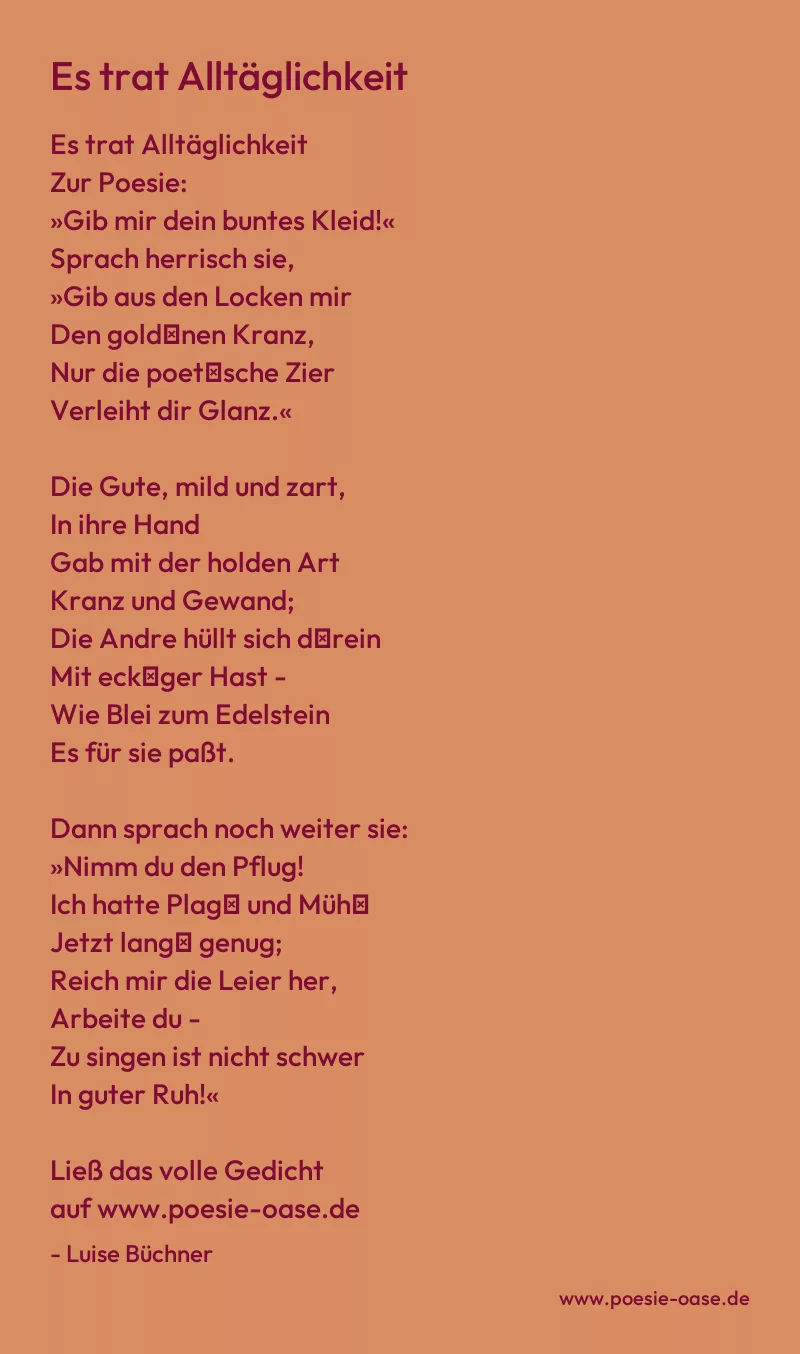Es trat Alltäglichkeit
Zur Poesie:
»Gib mir dein buntes Kleid!«
Sprach herrisch sie,
»Gib aus den Locken mir
Den gold′nen Kranz,
Nur die poet′sche Zier
Verleiht dir Glanz.«
Die Gute, mild und zart,
In ihre Hand
Gab mit der holden Art
Kranz und Gewand;
Die Andre hüllt sich d′rein
Mit eck′ger Hast –
Wie Blei zum Edelstein
Es für sie paßt.
Dann sprach noch weiter sie:
»Nimm du den Pflug!
Ich hatte Plag′ und Müh′
Jetzt lang′ genug;
Reich mir die Leier her,
Arbeite du –
Zu singen ist nicht schwer
In guter Ruh!«
Sie rührt die Saiten an
Mit rauher Hand,
Gefild und Waldesplan
Erstarrend stand,
Der Vogel fliegt erschreckt
Vom Ast empor,
Der Hirtenbube deckt
Sein lauschend Ohr.
Doch sieh′, die Himmelsmaid
Voll Majestät,
Mit Blicken strahlend weit,
Jetzt vor ihr steht,
Sie spricht: »Alltäglichkeit,
Erkenne dich!
Dich macht nicht Kranz noch Kleid
Zu dem, was ich.
Dein Thun veracht′ ich nie,
Es braucht die Welt
Uns beide; bleib′ wo sie
Dich hingestellt!
Du denkst im Müßiggang
Ging′ träg′ ich her –
Mein Weg ist schwer und lang,
Wie keiner mehr.
Ich baue früh und spat
Des Geistes Feld,
Der Zukunft gold′ne Saat
Mein Fleiß bestellt.
Und, wenn ich träumend geh′,
Ein Schattenbild,
Für tausendfaches Weh
Mir Trost entquillt.
Und meiner Seele Leid
Das ahnst du nie,
Weil du Alltäglichkeit,
Ich Poesie!«
Dann hob ihr Flügelpaar
Sie leise auf,
Wo ihre Heimath war,
Schwebt sie hinauf.