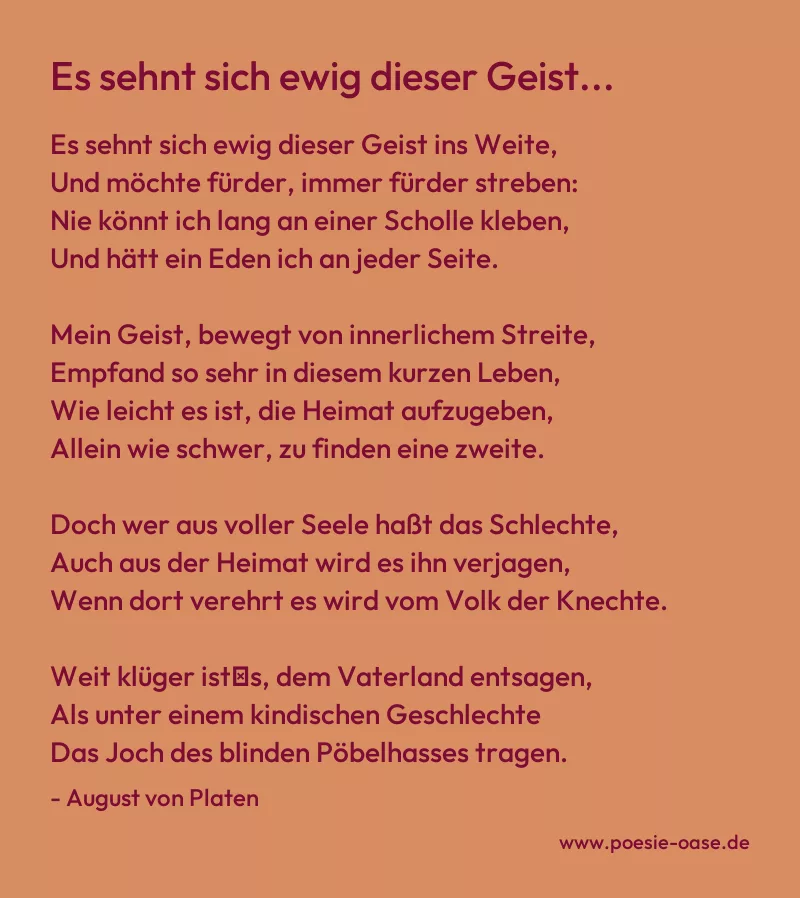Es sehnt sich ewig dieser Geist…
Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite,
Und möchte fürder, immer fürder streben:
Nie könnt ich lang an einer Scholle kleben,
Und hätt ein Eden ich an jeder Seite.
Mein Geist, bewegt von innerlichem Streite,
Empfand so sehr in diesem kurzen Leben,
Wie leicht es ist, die Heimat aufzugeben,
Allein wie schwer, zu finden eine zweite.
Doch wer aus voller Seele haßt das Schlechte,
Auch aus der Heimat wird es ihn verjagen,
Wenn dort verehrt es wird vom Volk der Knechte.
Weit klüger ist′s, dem Vaterland entsagen,
Als unter einem kindischen Geschlechte
Das Joch des blinden Pöbelhasses tragen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
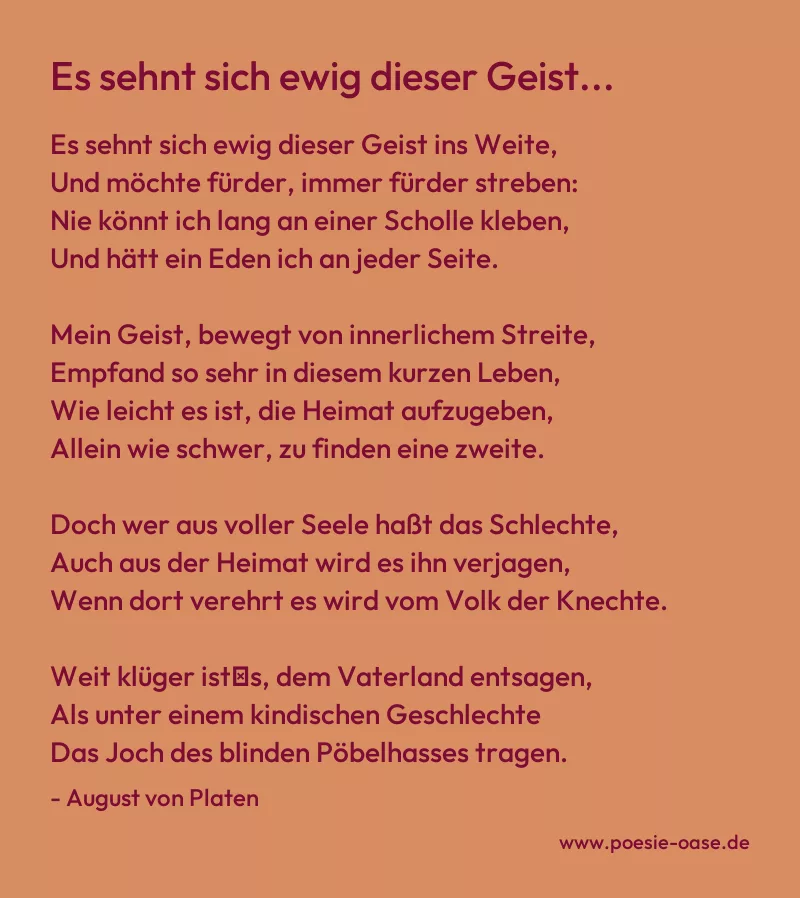
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Es sehnt sich ewig dieser Geist…“ von August von Platen reflektiert die innere Zerrissenheit eines Geistes, der sich nach Weite und Freiheit sehnt und die Begrenzung durch Heimat und Konventionen ablehnt. Das zentrale Thema ist die Sehnsucht nach einem Leben jenseits der eigenen, als beengend empfundenen Umgebung, verbunden mit der Schwierigkeit, eine neue Heimat zu finden, die den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Die ersten beiden Strophen etablieren diese Dualität: das unaufhörliche Streben nach Freiheit kontrastiert mit der Erkenntnis, dass das Verlassen der Heimat nicht zwangsläufig zu einem besseren Zustand führt.
In der zweiten Strophe wird diese Ambivalenz noch deutlicher: Das Verlassen der Heimat wird als leicht empfunden, doch das Finden einer neuen, gleichwertigen Heimat als schwierig. Dies verdeutlicht das Dilemma des lyrischen Ichs, das zwischen der Sehnsucht nach dem Unbekannten und der Angst vor der Verlorenheit oszilliert. Die innere Zerrissenheit, der „innerliche Streit“, wird so zum Motor des Gedichts. Die Erfahrung des „kurzen Lebens“ wird dabei zur prägenden Kraft, die das Bewusstsein für die begrenzte Zeit schärft und gleichzeitig die Suche nach einem erfüllteren Dasein antreibt.
Die dritte Strophe führt eine moralische Dimension ein, indem sie die Abneigung gegen das „Schlechte“ in den Vordergrund rückt. Die Heimat wird nun nicht nur als physischer Ort, sondern auch als moralisches Umfeld betrachtet. Die Ablehnung von „Volk der Knechte“ und „blinden Pöbelhasses“ deutet auf eine Kritik an Unterdrückung, Ignoranz und Engstirnigkeit hin. Die Heimat wird hier zur Chiffre für gesellschaftliche Zustände, die das lyrische Ich ablehnt. Der Wunsch nach Freiheit geht einher mit einem Streben nach moralischer Integrität.
Die letzte Strophe bietet eine klare Entscheidung: „dem Vaterland entsagen“ wird als die klügere Alternative dargestellt, wenn die Heimat durch das „Joch des blinden Pöbelhasses“ gekennzeichnet ist. Diese Entscheidung ist nicht leichtfertig, sondern resultiert aus der Abwägung zwischen der Sehnsucht nach Freiheit und der Ablehnung von Unterdrückung. Das Gedicht endet mit einer klaren Aussage über die Notwendigkeit, sich von einer Heimat zu lösen, die den eigenen moralischen und geistigen Ansprüchen nicht genügt, und deutet die Möglichkeit eines Neuanfangs an, ohne jedoch ein Versprechen auf ein besseres Schicksal zu geben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.