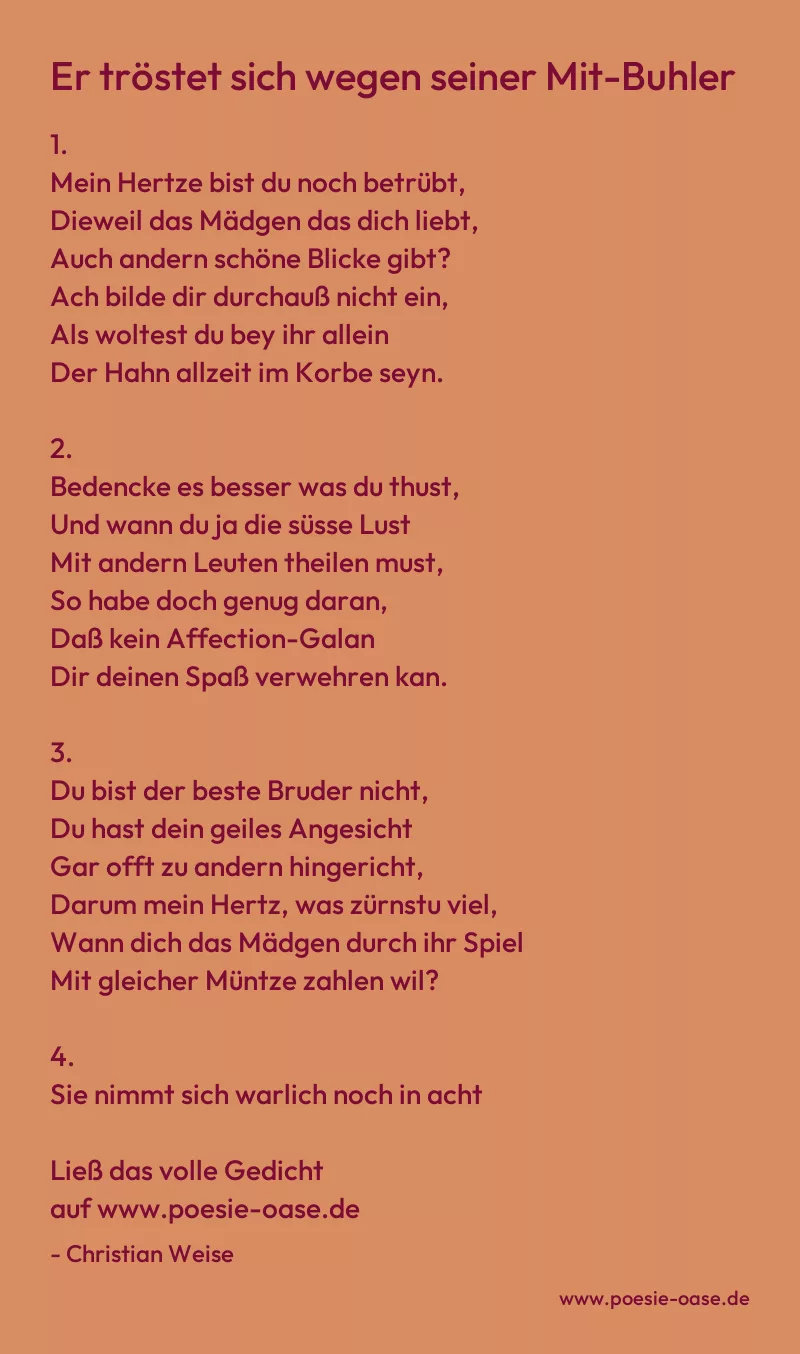Er tröstet sich wegen seiner Mit-Buhler
1.
Mein Hertze bist du noch betrübt,
Dieweil das Mädgen das dich liebt,
Auch andern schöne Blicke gibt?
Ach bilde dir durchauß nicht ein,
Als woltest du bey ihr allein
Der Hahn allzeit im Korbe seyn.
2.
Bedencke es besser was du thust,
Und wann du ja die süsse Lust
Mit andern Leuten theilen must,
So habe doch genug daran,
Daß kein Affection-Galan
Dir deinen Spaß verwehren kan.
3.
Du bist der beste Bruder nicht,
Du hast dein geiles Angesicht
Gar offt zu andern hingericht,
Darum mein Hertz, was zürnstu viel,
Wann dich das Mädgen durch ihr Spiel
Mit gleicher Müntze zahlen wil?
4.
Sie nimmt sich warlich noch in acht
Wann sie mit andern freundlich lacht
Daß sie es nicht zu lose macht,
Hergegen du bist so verpicht
Auffs liebe Brod und achtest nicht,
Ob dich ein ander gleich verspricht.
5.
Kein Mensch hat die beliebte Krafft
Der mehr als theuren Jungferschafft
Auß ihrer jungen Schos gerafft,
Du aber frage deinen Sinn
Wo hast du längsten den Gewinn
Der angebrannten Keuschheit hin.
6.
Und endlich kriegst du loser Dieb
Gleich manchen guten Lungen-Hieb,
Hat sie dich doch ein bißgen lieb:
Denn sie vertreibt die lange Zeit
Mit völliger Zufriedenheit
Bey dir und deiner Lustigkeit.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
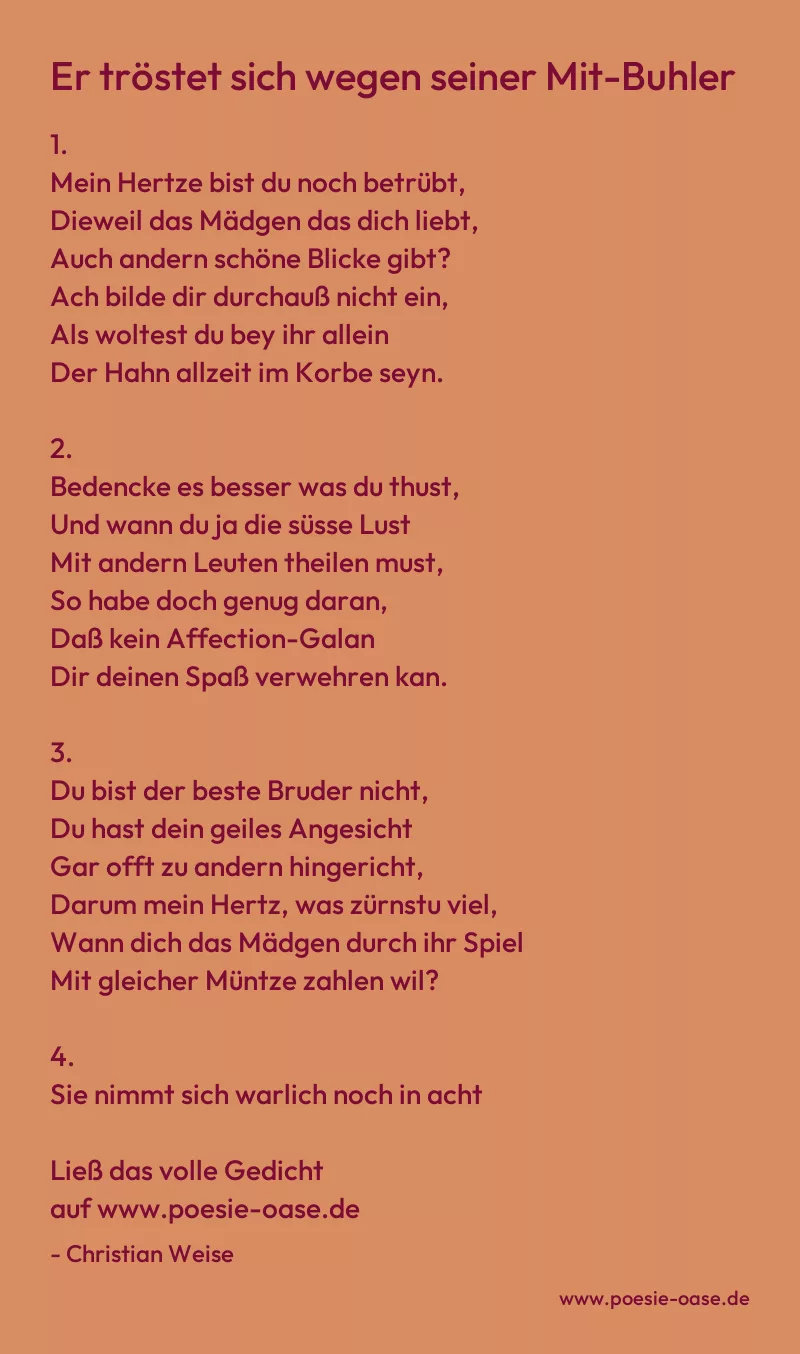
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Er tröstet sich wegen seiner Mit-Buhler“ von Christian Weise präsentiert eine ironische Selbstberuhigung eines Liebenden, der sich mit der Tatsache abfindet, dass seine Geliebte auch andere Verehrer hat. Das Gedicht, das aus sechs Strophen zu je sechs Versen besteht, offenbart eine Mischung aus Zynismus und Resignation, wobei der Sprecher versucht, seine Eifersucht zu rationalisieren und sich selbst zu trösten.
In den ersten beiden Strophen wird die Ausgangssituation etabliert: Der Liebende ist betrübt, weil die Geliebte auch anderen „schöne Blicke gibt“. Er versucht sich selbst zu beruhigen, indem er darauf hinweist, dass er nicht erwarten kann, der einzige Verehrer zu sein. Er appelliert an eine gewisse Gelassenheit und die Akzeptanz der Tatsache, dass er die „süsse Lust“ teilen muss. Die Betonung liegt auf der pragmatischen Haltung, dass er seinen „Spaß“ nicht durch Eifersucht verderben lassen soll.
Die dritte und vierte Strophe wenden sich einer Art von Selbstvorwurf zu. Der Sprecher erkennt an, dass er selbst untreu war und sein „geiles Angesicht“ oft zu anderen gerichtet hat. Damit rechtfertigt er in gewisser Weise das Verhalten seiner Geliebten. Er ist bereit, „mit gleicher Münze“ bezahlt zu werden. Die vierte Strophe unterstreicht die Heuchelei, indem der Sprecher die Geliebte für ihre Zurückhaltung lobt, während er selbst „verpicht“ auf die „liebe Brod“ ist, also seine eigenen Vergnügungen sucht.
Die letzten beiden Strophen verstärken den ironischen Unterton. Der Sprecher hinterfragt die vermeintliche „Krafft“ der Jungfräulichkeit, was auf seine eigene mangelnde Keuschheit anspielt. Er scheint sich weniger um die moralischen Aspekte zu kümmern, sondern vielmehr um den eigenen Spaß und die „Lustigkeit“. Trotzdem deutet die letzte Strophe an, dass die Geliebte ihn zumindest „ein bißgen lieb“ hat, und er sich mit dieser „völliger Zufriedenheit“ tröstet.
Insgesamt ist das Gedicht eine amüsante Darstellung einer unsentimentalen Liebe. Weise kritisiert unterschwellig die Doppelmoral des Liebenden, der sich selbst als genauso schuldig betrachtet wie die Geliebte, und seine Selbstberuhigung als ein Produkt von Pragmatismus und Selbstbetrug. Das Gedicht fängt die Komplexität menschlicher Beziehungen mit einer Mischung aus Ironie, Selbstreflexion und einer gehörigen Portion Zynismus ein.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.