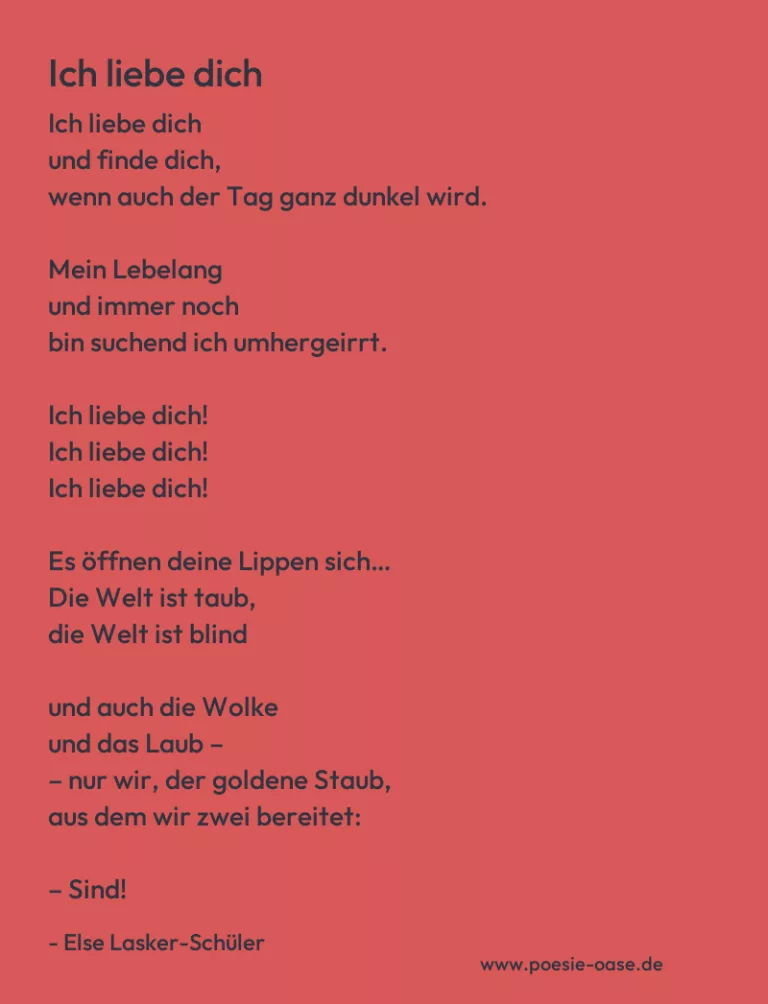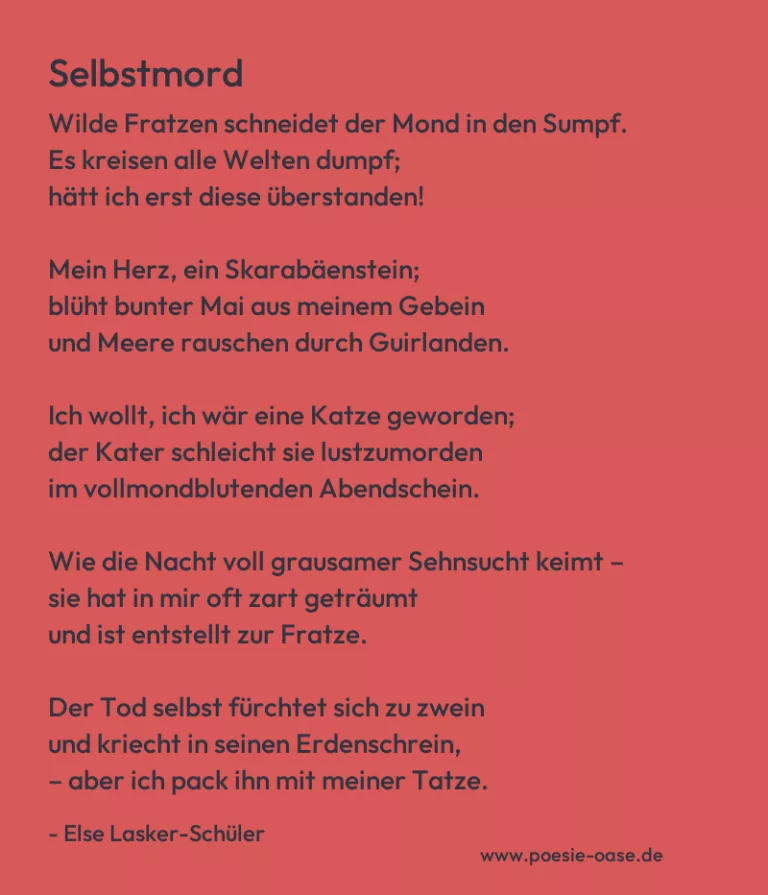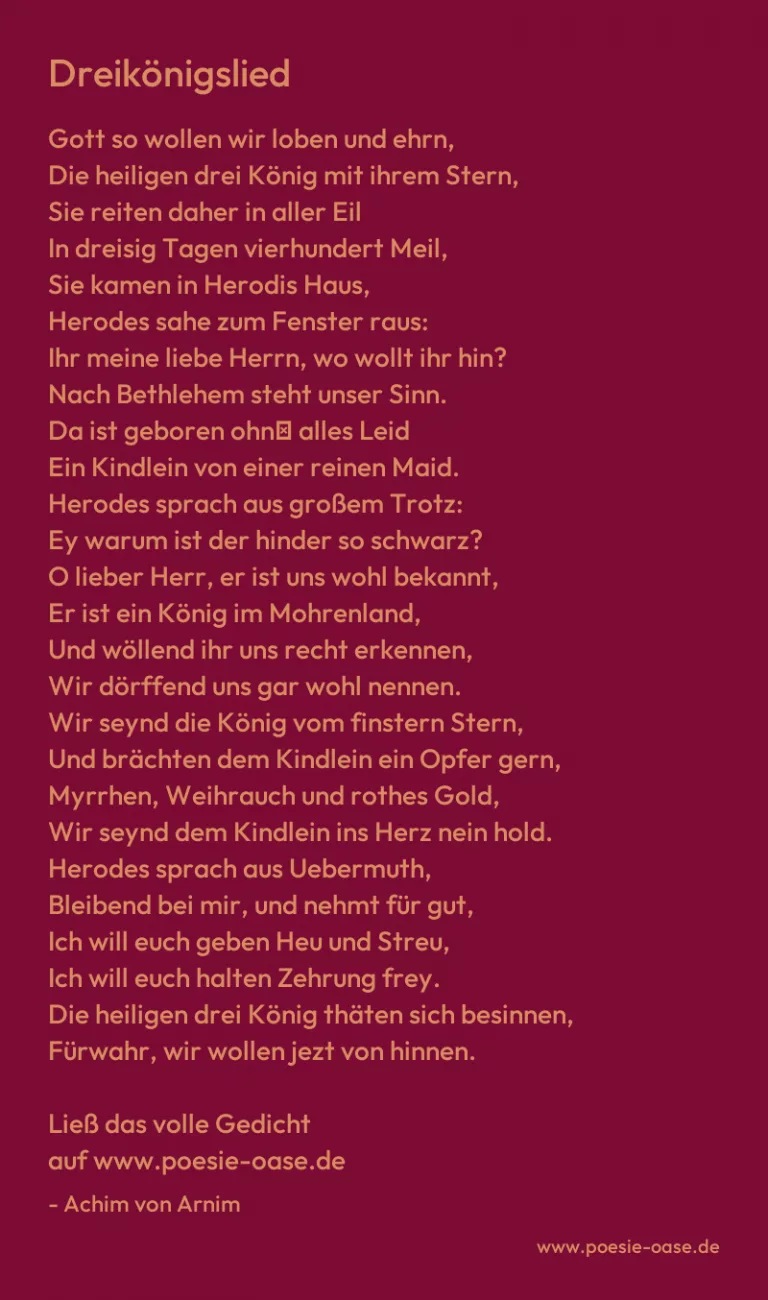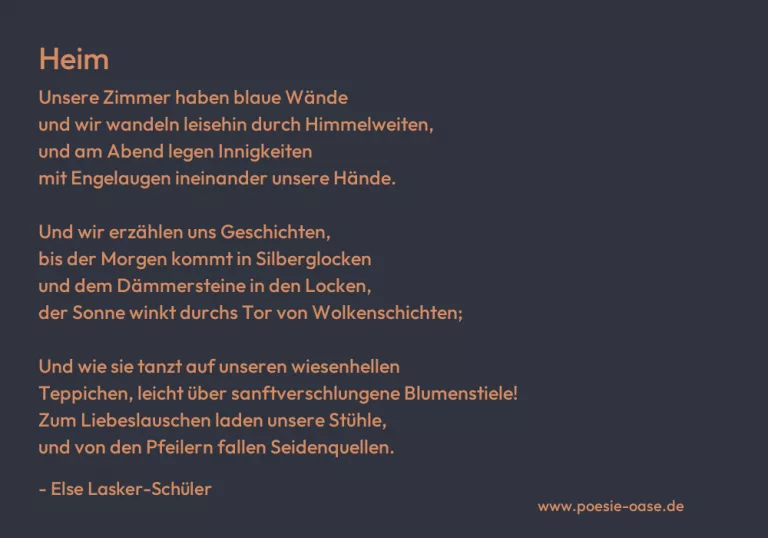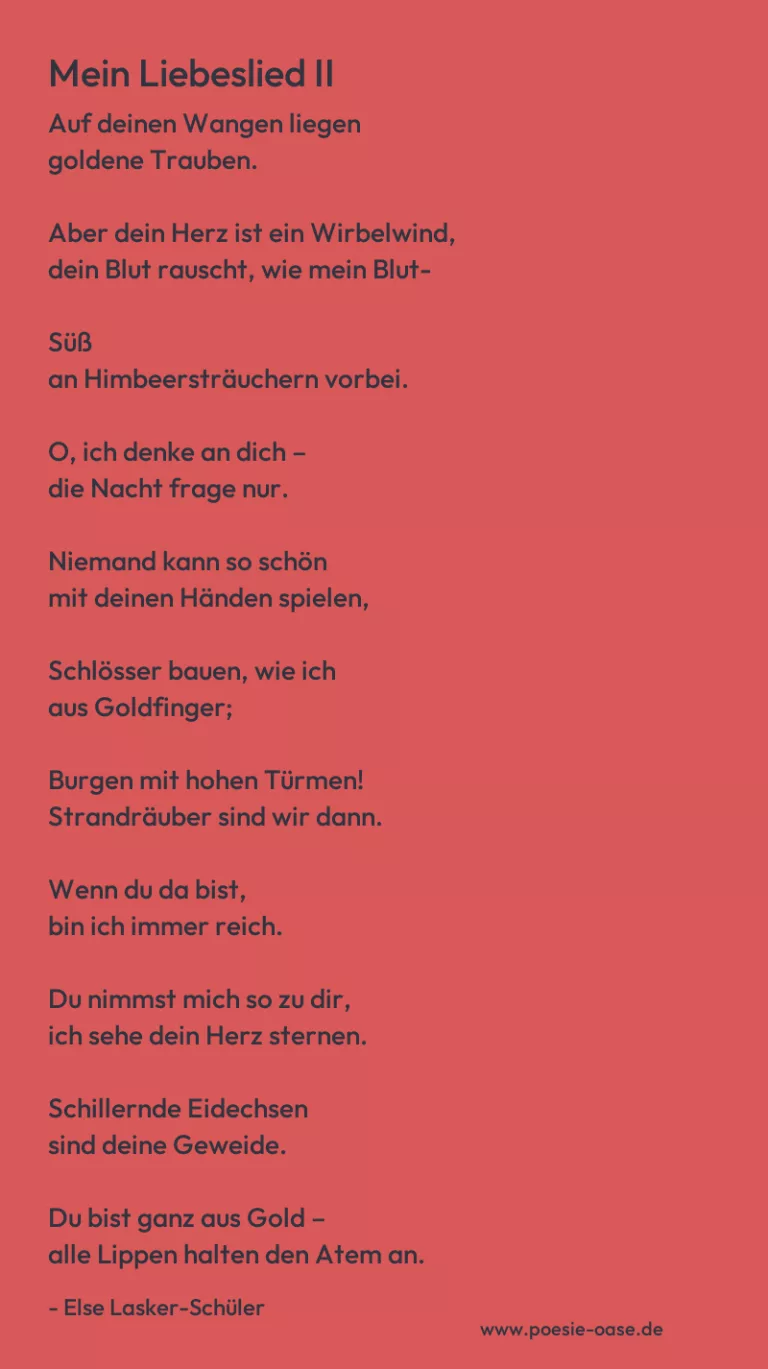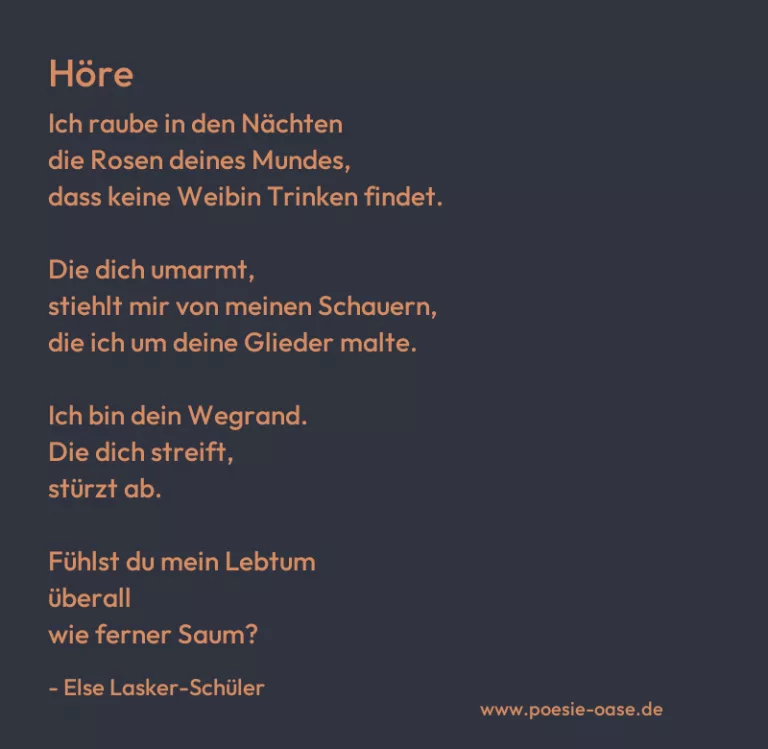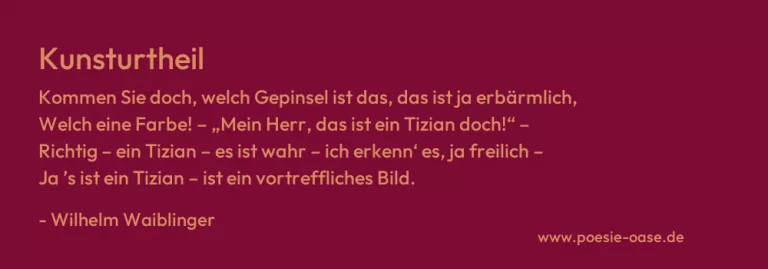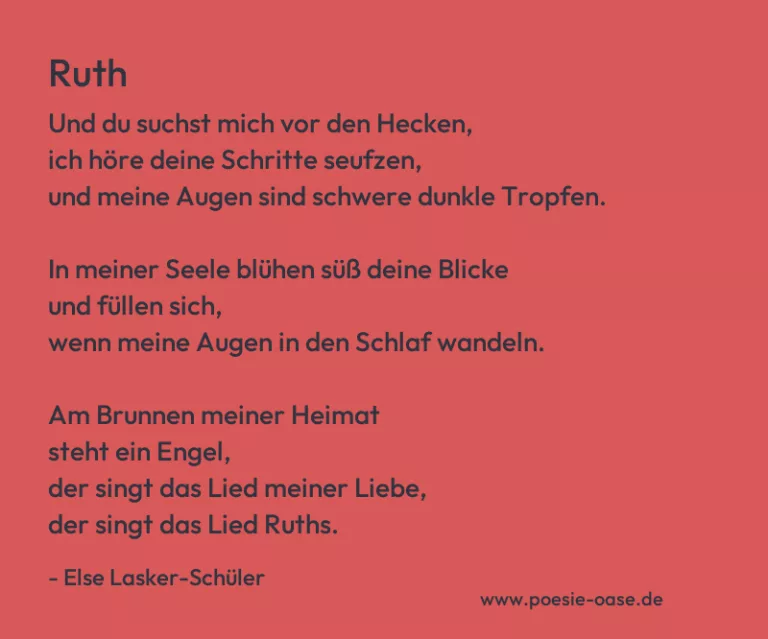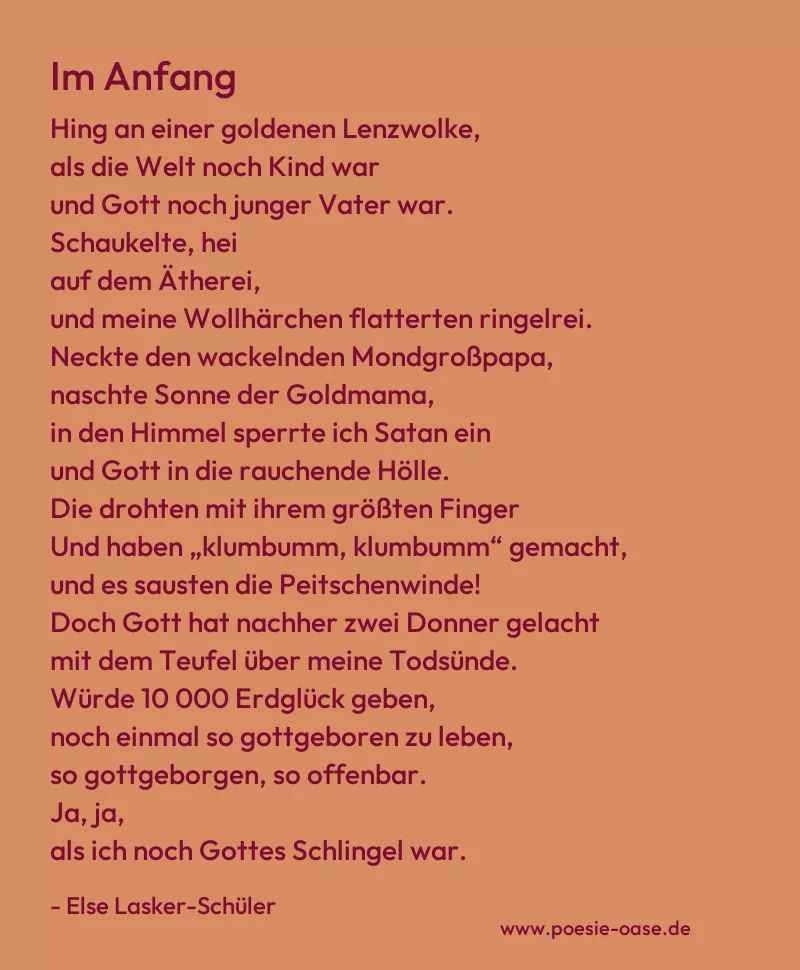Im Anfang
Hing an einer goldenen Lenzwolke,
als die Welt noch Kind war
und Gott noch junger Vater war.
Schaukelte, hei
auf dem Ätherei,
und meine Wollhärchen flatterten ringelrei.
Neckte den wackelnden Mondgroßpapa,
naschte Sonne der Goldmama,
in den Himmel sperrte ich Satan ein
und Gott in die rauchende Hölle.
Die drohten mit ihrem größten Finger
Und haben „klumbumm, klumbumm“ gemacht,
und es sausten die Peitschenwinde!
Doch Gott hat nachher zwei Donner gelacht
mit dem Teufel über meine Todsünde.
Würde 10 000 Erdglück geben,
noch einmal so gottgeboren zu leben,
so gottgeborgen, so offenbar.
Ja, ja,
als ich noch Gottes Schlingel war.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
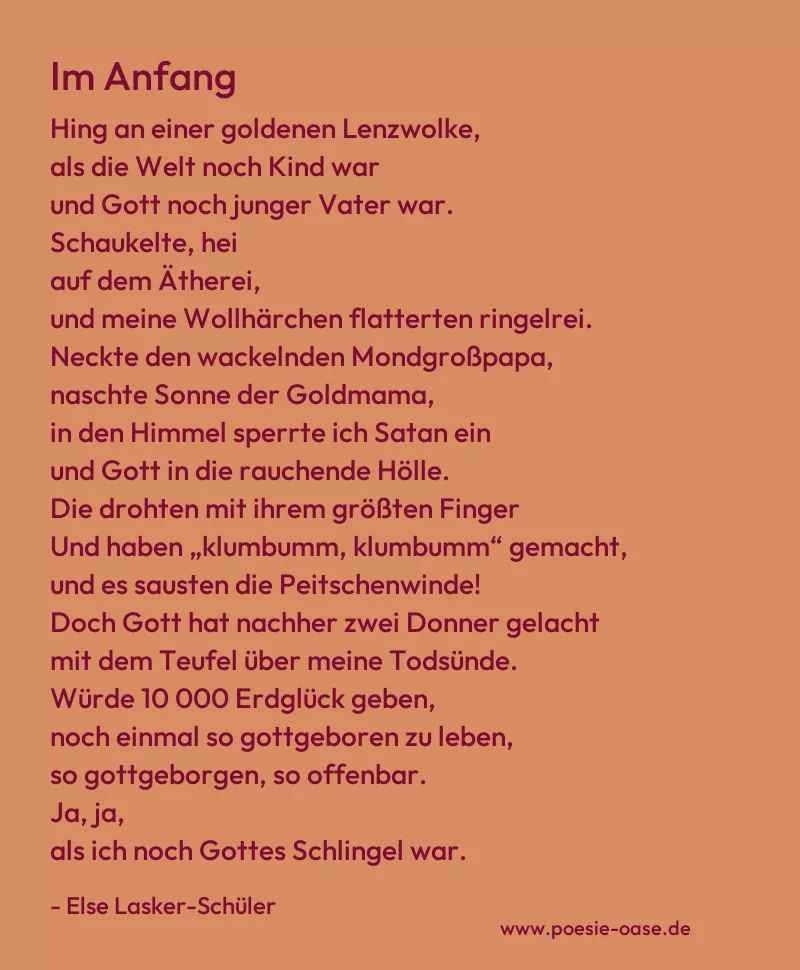
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Im Anfang“ von Else Lasker-Schüler entwirft ein Bild einer kindlich-naiven, gleichzeitig aber kraftvollen und spielerischen Welt, in der das Göttliche und das Menschliche miteinander verschmelzen. In der ersten Strophe wird das Bild einer „goldenen Lenzwolke“ verwendet, um den Beginn einer Welt zu beschreiben, die noch jung und unerfahren ist – eine Welt, in der die Zeit selbst noch im Entstehen begriffen ist. Das Kindsein wird mit einer gewissen Unschuld und Unbeschwertheit dargestellt, wobei „Gott noch junger Vater“ ist und das „Ätherei“ die Freiheit des Himmels symbolisiert. Diese Welt, die die Dichterin beschreibt, ist geprägt von kindlicher Verspieltheit und einer engen Verbindung zur Natur.
Die zweite Strophe beschreibt das kindliche Spiel mit den großen kosmischen Kräften. Das Kind, als „Schlingel“, ist voller Streiche und Trotz – es „neckt den wackelnden Mondgroßpapa“ und „nascht Sonne der Goldmama“. Die Bilder sind von einer märchenhaften, fast humorvollen Naivität durchzogen, doch die Schilderung hat auch etwas Unheimliches, wenn das Kind Gott und Satan in seine eigenen Spielwelten einbezieht. Der „größte Finger“ als Bedrohung und das „klumbumm, klumbumm“ der drohenden Gewalt symbolisieren die ersten Erfahrungen des Kindes mit Konflikten und dem Spiel mit den Grenzen des Universums.
Die drohende Strafe durch Gott und den Teufel („die drohten mit ihrem größten Finger“) und die „Peitschenwinde“ stellen das Gefühl von Gefahr und Bestrafung dar, das oft in kindlichen Vorstellungen von Autorität und Macht vorkommt. Doch in der letzten Zeile dieser Strophe wird das Bild versöhnlich, als „Gott nachher zwei Donner gelacht“ und „mit dem Teufel über meine Todsünde“ gesprochen wird. Dies deutet auf eine gewisse Verspieltheit und das Fehlen einer tiefen moralischen Schwere hin – vielmehr wird das Kind als ein ungezogener, aber liebenswerter „Schlingel“ gesehen.
Die abschließenden Verse des Gedichts reflektieren eine Nostalgie für die kindliche Freiheit und Unschuld. Das Verlangen, „noch einmal so gottgeboren zu leben“, zeigt eine tiefe Sehnsucht nach der Rückkehr zu dieser unschuldigen, göttlich geborgenen Existenz. Die Phrase „so gottgeborgen, so offenbar“ verdeutlicht das Gefühl einer tiefen, bedingungslosen Zugehörigkeit zu einer ursprünglichen Quelle der Existenz. Die abschließende Bestätigung „Ja, ja, als ich noch Gottes Schlingel war“ ist eine Rückkehr zu dieser verspielt-göttlichen Unschuld, die sich aus der kindlichen Perspektive mit einer fast heiligen, anarchischen Energie verbindet.
Else Lasker-Schüler gelingt es mit „Im Anfang“, eine Welt zu erschaffen, die sowohl unschuldig als auch rebellisch ist, eine Welt, in der das Göttliche und das Weltliche miteinander tanzen und der menschliche Akt des Spiels mit den Kräften des Universums eine tiefe, fast mythische Bedeutung erhält. Es ist ein Gedicht über die Freiheit des Kindseins, die unschuldige Verführung des Bösen und die Sehnsucht nach einer Rückkehr in einen Zustand der göttlichen Geborgenheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.