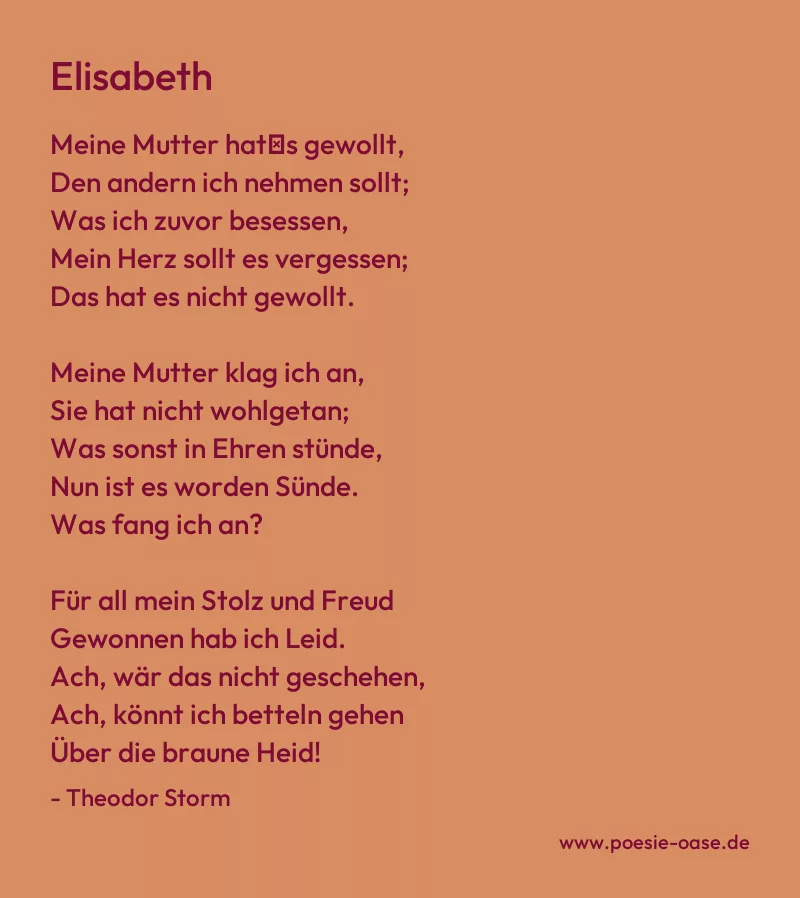Elisabeth
Meine Mutter hat′s gewollt,
Den andern ich nehmen sollt;
Was ich zuvor besessen,
Mein Herz sollt es vergessen;
Das hat es nicht gewollt.
Meine Mutter klag ich an,
Sie hat nicht wohlgetan;
Was sonst in Ehren stünde,
Nun ist es worden Sünde.
Was fang ich an?
Für all mein Stolz und Freud
Gewonnen hab ich Leid.
Ach, wär das nicht geschehen,
Ach, könnt ich betteln gehen
Über die braune Heid!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
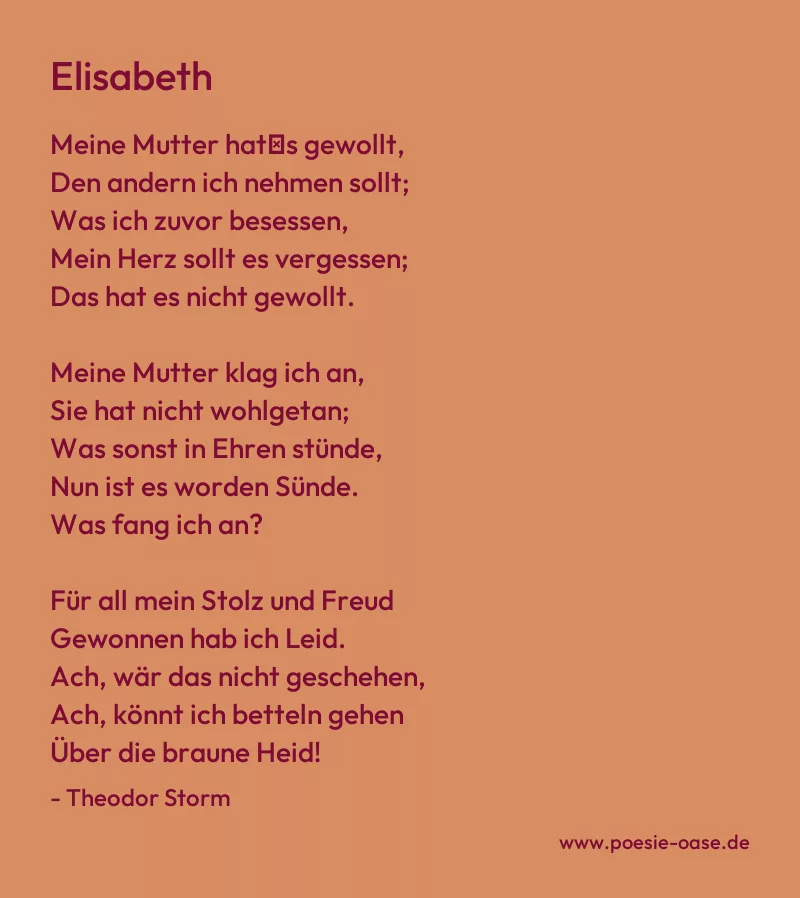
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Elisabeth“ von Theodor Storm ist eine kurze, aber eindringliche Klage über erzwungene Liebe und den Verlust persönlicher Wünsche. Es offenbart die innere Zerrissenheit einer jungen Frau, die gegen ihren Willen in eine Ehe gezwungen wurde und nun unter den Folgen dieser Entscheidung leidet. Die Mutter, ursprünglich die treibende Kraft hinter der arrangierten Heirat, wird zur Zielscheibe des Unmuts, während die eigentliche Liebe unerfüllt bleiben muss.
Die Struktur des Gedichts ist präzise und wirkungsvoll. Die drei Strophen bauen aufeinander auf, wobei jede einen neuen Aspekt des Leids der Protagonistin beleuchtet. Die erste Strophe etabliert den Konflikt: die erzwungene Heirat und der Versuch, die frühere Liebe zu vergessen. Die zweite Strophe verstärkt die Bitterkeit, indem sie die Mutter als Schuldige anprangert, die das einst Wertvolle in etwas Verbotenes verwandelt hat. Der letzte Vers „Was fang ich an?“ drückt Verzweiflung und Hilflosigkeit aus. Die dritte Strophe kulminiert in einem Ausruf der Reue und Sehnsucht nach einem einfachen, bescheidenen Leben, fernab von den Zwängen und dem Leid der erzwungenen Ehe.
Der emotionale Kern des Gedichts wird durch einfache, fast volksliedhafte Sprache verstärkt. Die Wiederholungen und die klaren Reime erzeugen eine gewisse Melancholie und unterstreichen die Einfachheit des menschlichen Schmerzes. Die Verwendung von Ausrufen wie „Ach“ und rhetorischen Fragen wie „Was fang ich an?“ vertieft das Gefühl von Verzweiflung und die innere Leere der Protagonistin. Der Kontrast zwischen dem verlorenen Glück und der gegenwärtigen Not wird durch die knappen, aber eindringlichen Worte verdeutlicht.
Die letzte Strophe ist besonders bewegend, da sie die Sehnsucht nach einem früheren Leben und einem einfachen Glück zum Ausdruck bringt. Die Vorstellung, „betteln zu gehen über die braune Heid“, symbolisiert den Wunsch nach Freiheit von den gesellschaftlichen Konventionen und dem Leid, das durch die erzwungene Heirat entstanden ist. Das Gedicht ist somit eine universelle Reflexion über die Zerstörung individueller Wünsche und die Tragweite erzwungener Entscheidungen. Es ist ein eindrucksvolles Zeugnis der menschlichen Seele, gefangen zwischen Pflicht, Sehnsucht und dem schmerzhaften Verlust des eigenen Glücks.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.