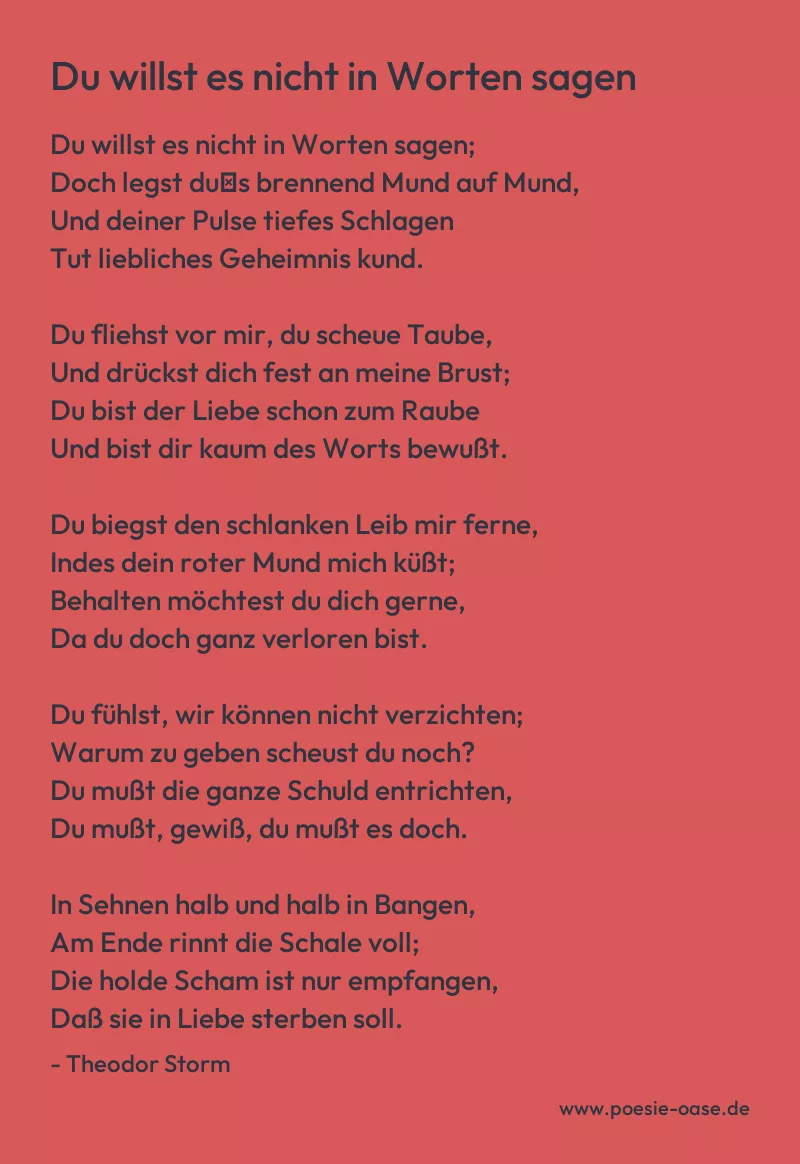Du willst es nicht in Worten sagen
Du willst es nicht in Worten sagen;
Doch legst du′s brennend Mund auf Mund,
Und deiner Pulse tiefes Schlagen
Tut liebliches Geheimnis kund.
Du fliehst vor mir, du scheue Taube,
Und drückst dich fest an meine Brust;
Du bist der Liebe schon zum Raube
Und bist dir kaum des Worts bewußt.
Du biegst den schlanken Leib mir ferne,
Indes dein roter Mund mich küßt;
Behalten möchtest du dich gerne,
Da du doch ganz verloren bist.
Du fühlst, wir können nicht verzichten;
Warum zu geben scheust du noch?
Du mußt die ganze Schuld entrichten,
Du mußt, gewiß, du mußt es doch.
In Sehnen halb und halb in Bangen,
Am Ende rinnt die Schale voll;
Die holde Scham ist nur empfangen,
Daß sie in Liebe sterben soll.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
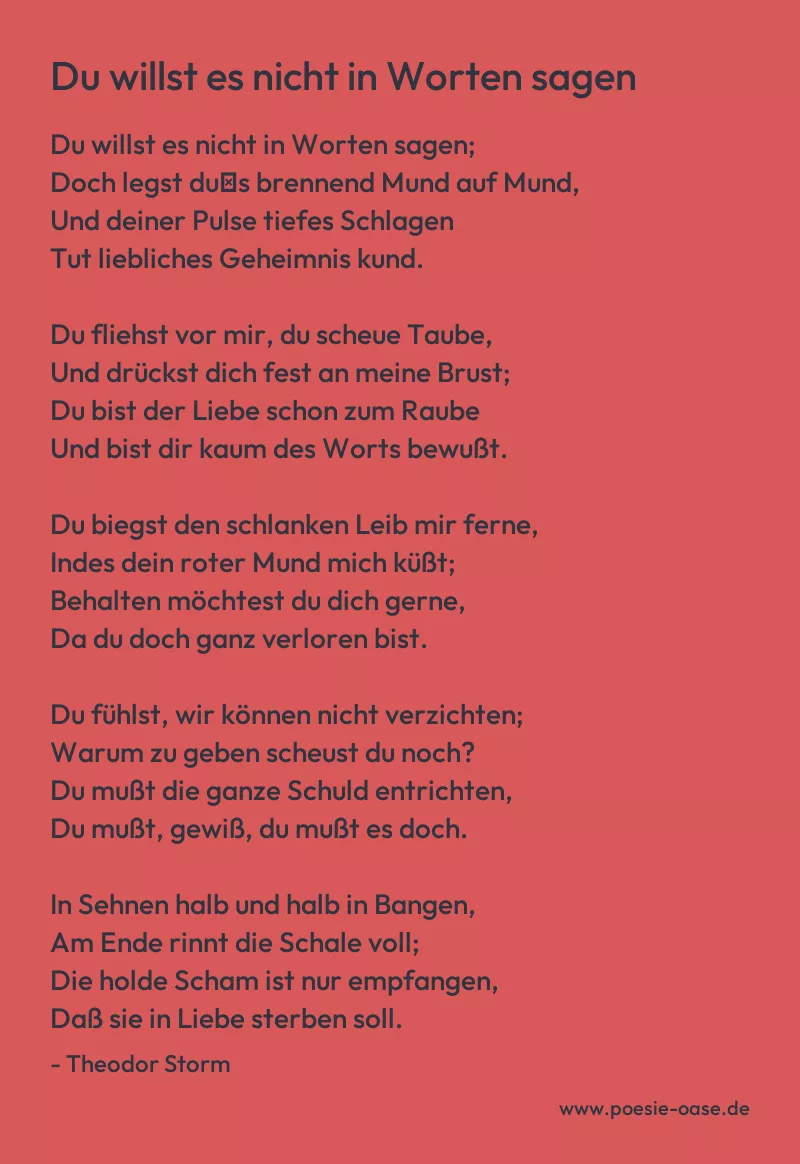
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Du willst es nicht in Worten sagen“ von Theodor Storm ist eine intime Beschreibung eines sich anbahnenden Liebesakts, der von einer Spannung zwischen Verlangen und Widerstand geprägt ist. Der lyrische Sprecher beobachtet und kommentiert die widersprüchlichen Signale seiner geliebten Person, die einerseits eine tiefe körperliche Anziehungskraft ausstrahlt, andererseits aber versucht, ihre Gefühle zu verbergen. Die zentralen Themen des Gedichts sind das Verlangen, die Hemmung und die schließlich nachgebende Hingabe.
In den ersten Strophen wird das ambivalente Verhalten der Geliebten deutlich. Sie kommuniziert ihre Gefühle nonverbal durch Küsse und das Schlagen ihrer Pulse, während sie gleichzeitig versucht, sich der Situation zu entziehen. Dies wird durch Metaphern wie „scheue Taube“ und „Raube“ ausgedrückt, die das Zögern und die innere Zerrissenheit der Frau symbolisieren. Der Sprecher erkennt jedoch die Wahrheit hinter ihrem Verhalten: Ihre körperliche Reaktion verrät ihre wahre Sehnsucht, die stärker ist als ihre Worte oder ihr Widerstand. Die Spannung zwischen der ablehnenden Haltung und dem tiefen Verlangen bildet das zentrale Spannungsfeld des Gedichts.
Die dritte und vierte Strophe intensivieren die erotische Spannung weiter. Die körperliche Distanz („Du biegst den schlanken Leib mir ferne“) und die gleichzeitige Nähe durch Küsse unterstreichen die widersprüchliche Natur des Begehrens. Der Sprecher scheint die Situation zu verstehen und fordert seine Geliebte auf, ihre Hemmungen aufzugeben und sich der Liebe hinzugeben. Die Formulierung „Du mußt die ganze Schuld entrichten“ klingt dabei paradox, da sie die Hingabe als „Schuld“ bezeichnet, aber gleichzeitig die unvermeidliche Konsequenz des Verlangens betont.
In der abschließenden Strophe erreicht die Spannung ihren Höhepunkt und löst sich schließlich auf. Die Metapher „Am Ende rinnt die Schale voll“ deutet auf die ultimative Hingabe und das Nachgeben gegenüber dem Verlangen hin. Die „holde Scham“ wird als Empfindung beschrieben, die in Liebe „sterben soll“, was auf die Auflösung der Hemmungen und die vollständige Ergebung in die Leidenschaft hindeutet. Storm zeichnet hier ein Bild des Liebesaktes als einen Prozess des Überwindens von Widerstand, der in einer vollständigen Verschmelzung mündet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.