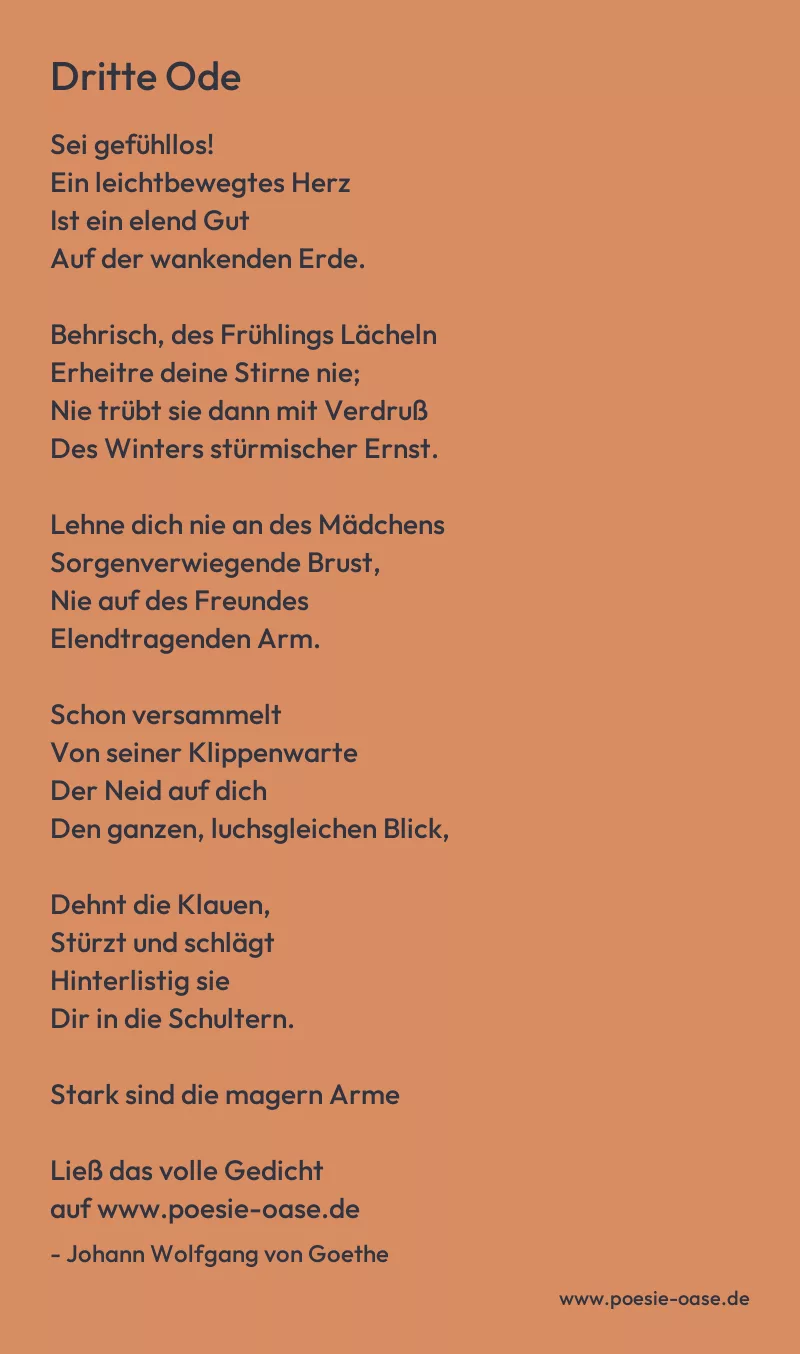Sei gefühllos!
Ein leichtbewegtes Herz
Ist ein elend Gut
Auf der wankenden Erde.
Behrisch, des Frühlings Lächeln
Erheitre deine Stirne nie;
Nie trübt sie dann mit Verdruß
Des Winters stürmischer Ernst.
Lehne dich nie an des Mädchens
Sorgenverwiegende Brust,
Nie auf des Freundes
Elendtragenden Arm.
Schon versammelt
Von seiner Klippenwarte
Der Neid auf dich
Den ganzen, luchsgleichen Blick,
Dehnt die Klauen,
Stürzt und schlägt
Hinterlistig sie
Dir in die Schultern.
Stark sind die magern Arme
Wie Pantherarme,
Er schüttelt dich
Und reißt dich los.
Tod ist Trennung,
Dreifacher Tod
Trennung ohne Hoffnung
Wiederzusehn.
Gerne verließest du
Dieses gehaßte Land,
Hielte dich nicht Freundschaft
Mit Blumenfesseln an mir.
Zerreiß sie! Ich klage nicht.
Kein edler Freund
Hält den Mitgefangnen,
Der fliehn kann, zurück.
Der Gedanke
Von des Freundes Freiheit
Ist ihm Freiheit
Im Kerker.
Du gehst, ich bleibe.
Aber schon drehen
Des letzten Jahrs Flügelspeichel
Sich um die rauchende Achse.
Ich zähle die Schläge
Des donnernden Rads,
Segne den letzten,
Da springen die Riegel, frei bin ich wie du.