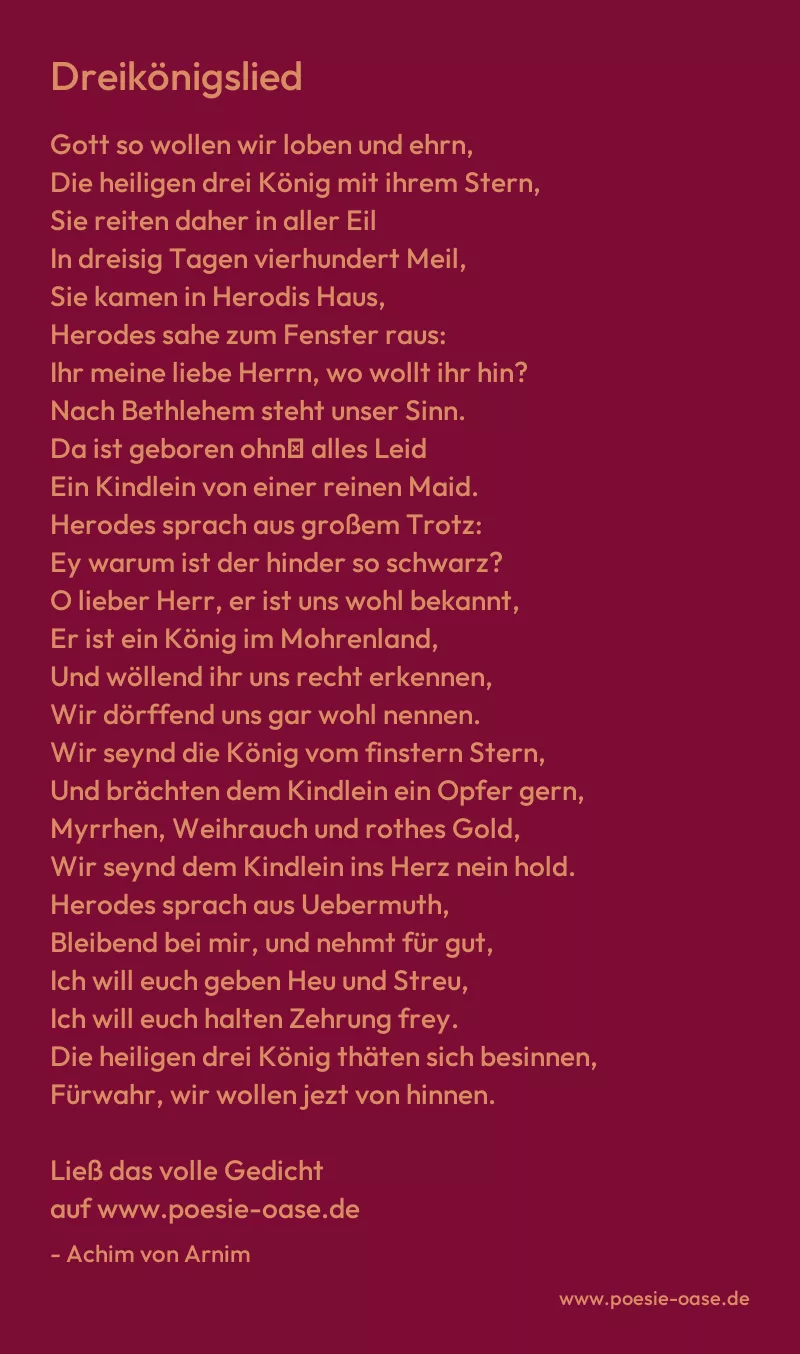Dreikönigslied
Gott so wollen wir loben und ehrn,
Die heiligen drei König mit ihrem Stern,
Sie reiten daher in aller Eil
In dreisig Tagen vierhundert Meil,
Sie kamen in Herodis Haus,
Herodes sahe zum Fenster raus:
Ihr meine liebe Herrn, wo wollt ihr hin?
Nach Bethlehem steht unser Sinn.
Da ist geboren ohn′ alles Leid
Ein Kindlein von einer reinen Maid.
Herodes sprach aus großem Trotz:
Ey warum ist der hinder so schwarz?
O lieber Herr, er ist uns wohl bekannt,
Er ist ein König im Mohrenland,
Und wöllend ihr uns recht erkennen,
Wir dörffend uns gar wohl nennen.
Wir seynd die König vom finstern Stern,
Und brächten dem Kindlein ein Opfer gern,
Myrrhen, Weihrauch und rothes Gold,
Wir seynd dem Kindlein ins Herz nein hold.
Herodes sprach aus Uebermuth,
Bleibend bei mir, und nehmt für gut,
Ich will euch geben Heu und Streu,
Ich will euch halten Zehrung frey.
Die heiligen drei König thäten sich besinnen,
Fürwahr, wir wollen jezt von hinnen.
Herodes sprach aus trutzigem Sinn,
Wollt ihr nicht bleiben, so fahret hin.
Sie zogen über den Berg hinaus,
Sie funden den Stern ob dem Haus,
Sie traten in das Haus hinein,
Sie funden Jesum in dem Krippelein.
Sie gaben ihm ein reichen Sold,
Myrrhen, Weyhrauch und rothes Gold.
Joseph bei dem Kripplein saß,
Bis daß er schier erfroren was.
Joseph nahm ein Pfännelein,
Und macht dem Kind ein Müßelein.
Joseph, der zog seine Höselein aus,
Und macht dem Kindlein zwey Windelein d′raus.
Joseph, lieber Joseph mein,
Hilf mir wiegen mein Kindelein.
Es waren da zwey unvernünftige Thier,
Sie fielen nieder auf ihre Knie.
Das Oechselein und das Eselein,
Die kannten Gott den Herren rein.
Amen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
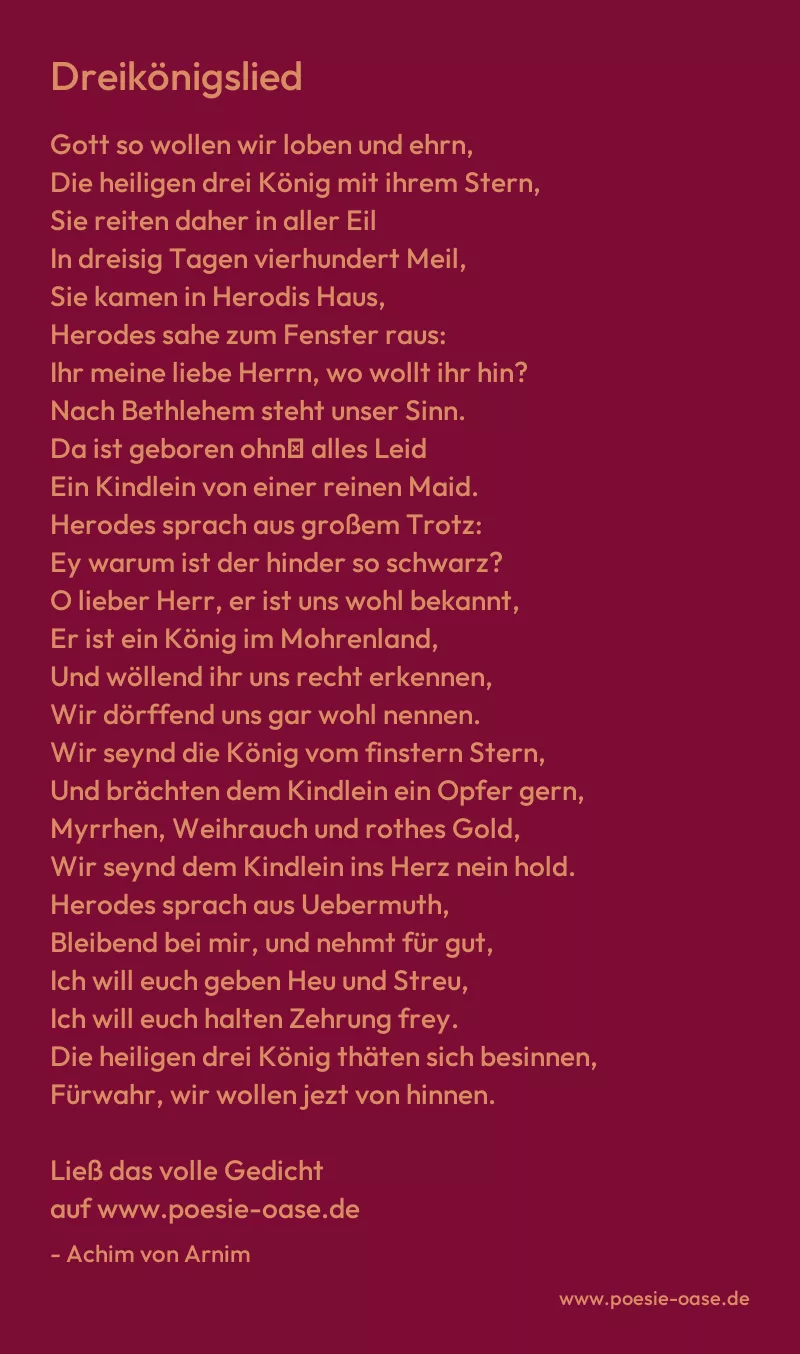
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dreikönigslied“ von Achim von Arnim erzählt die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die dem neugeborenen Jesus folgen und ihm ihre Gaben darbringen. Das Gedicht ist in einem volkstümlichen Stil verfasst, der an mittelalterliche Balladen erinnert. Der Text ist geprägt von einer einfachen Sprache und klaren Reimschemata, wodurch er leicht verständlich und eingängig wirkt. Das Gedicht erzählt nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern enthält auch Elemente von Konflikt und spiritueller Erkenntnis.
Im Zentrum des Gedichts steht die Begegnung der Weisen aus dem Morgenland mit König Herodes, der von deren Reise nach Bethlehem erfährt. Herodes, erfüllt von Hochmut und Furcht vor einem möglichen Rivalen, versucht die Könige zu manipulieren und vom Ziel abzulenken. Dies wird in den Versen „Herodes sprach aus großem Trotz“ und „Herodes sprach aus Uebermuth“ deutlich. Die Heiligen Drei Könige durchschauen jedoch Herodes‘ Absichten und setzen ihren Weg unbeirrt fort. Ihre Weigerung, sich von Herodes‘ weltlichen Angeboten verführen zu lassen, zeigt ihre tiefe Hingabe an den Glauben und ihre Entschlossenheit, Jesus zu huldigen.
Die Reise der Könige wird als eine spirituelle Suche dargestellt, die durch den Stern von Bethlehem geleitet wird. Die Erwähnung der Gaben – Myrrhe, Weihrauch und Gold – unterstreicht die königliche und göttliche Natur Jesu. Das Gedicht endet mit der Ankunft der Könige in der Krippe, wo sie Jesus finden und ihm ihre Gaben darbringen. Die Szene wird durch die Anwesenheit Josephs und die Anbetung von Ochs und Esel ergänzt. Dies betont die Demut und die universelle Bedeutung des Ereignisses, das nicht nur für Könige, sondern auch für Tiere von Bedeutung ist.
Der volksliedhafte Charakter des Gedichts verstärkt seine narrative Wirkung. Die Einfachheit der Sprache, kombiniert mit den biblischen Elementen, macht das Gedicht zu einem lebendigen und ansprechenden Zeugnis der Weihnachtsgeschichte. Das Gedicht ist nicht nur eine Erzählung, sondern eine Feier des Glaubens, der Hoffnung und der göttlichen Liebe. Es vermittelt eine Botschaft der Hoffnung und des Glaubens, die bis heute von Bedeutung ist und eine zeitlose Botschaft der spirituellen Erkenntnis beinhaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.