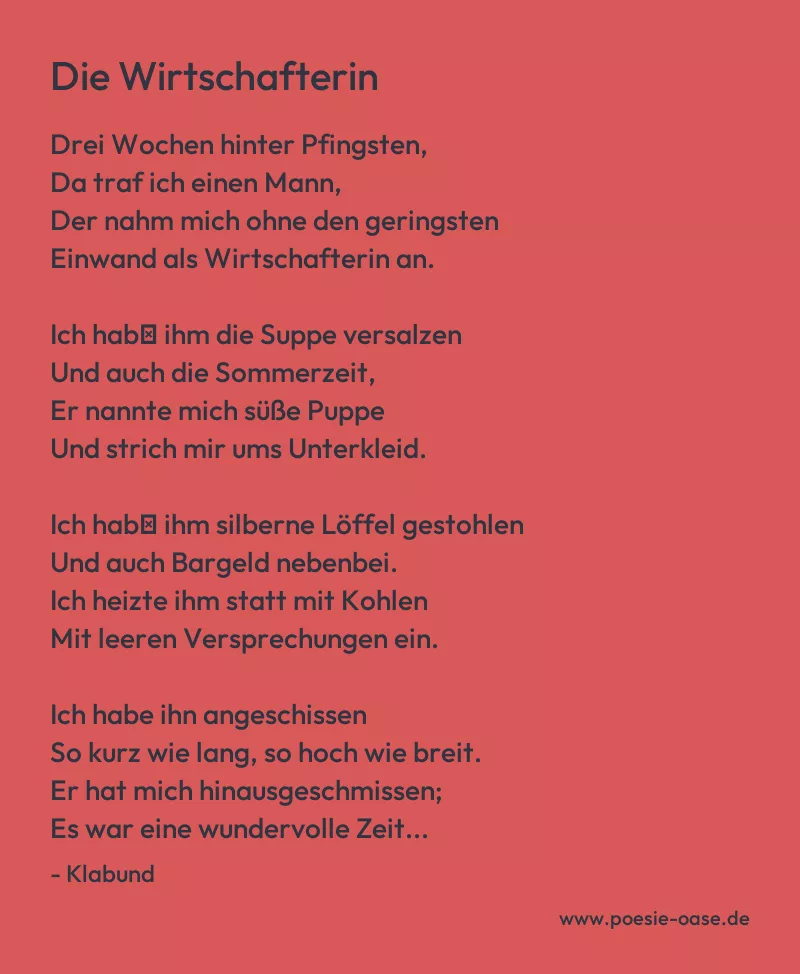Die Wirtschafterin
Drei Wochen hinter Pfingsten,
Da traf ich einen Mann,
Der nahm mich ohne den geringsten
Einwand als Wirtschafterin an.
Ich hab′ ihm die Suppe versalzen
Und auch die Sommerzeit,
Er nannte mich süße Puppe
Und strich mir ums Unterkleid.
Ich hab′ ihm silberne Löffel gestohlen
Und auch Bargeld nebenbei.
Ich heizte ihm statt mit Kohlen
Mit leeren Versprechungen ein.
Ich habe ihn angeschissen
So kurz wie lang, so hoch wie breit.
Er hat mich hinausgeschmissen;
Es war eine wundervolle Zeit…
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
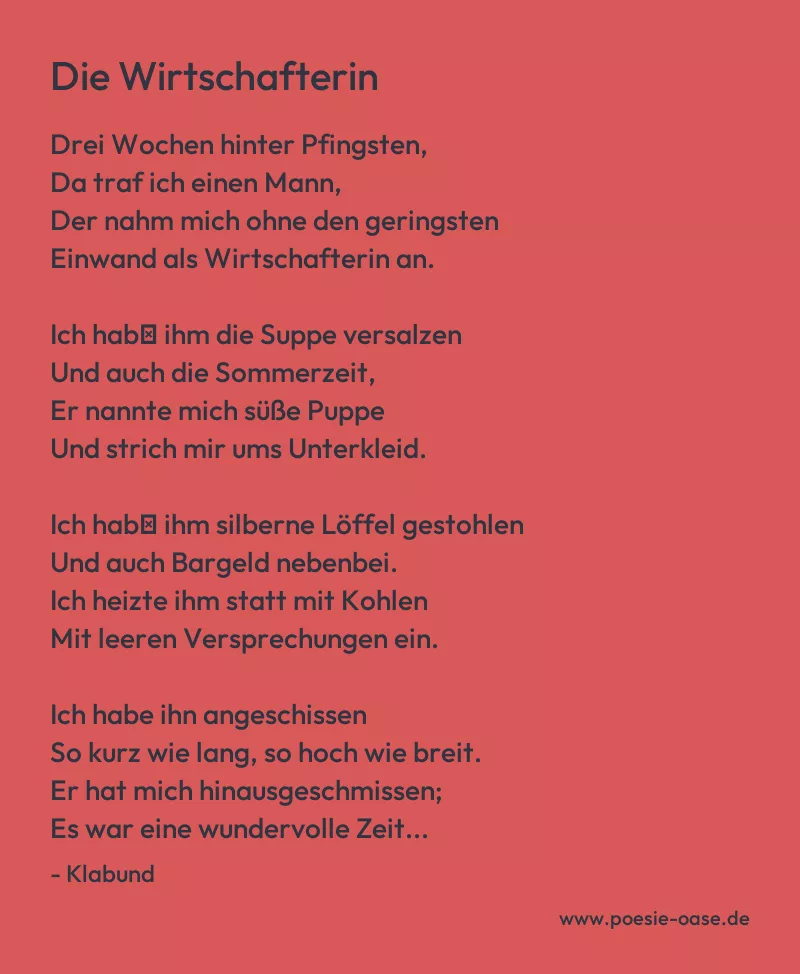
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Wirtschafterin“ von Klabund erzählt in einer schelmischen, fast schon frechen Weise von einer Frau, die in einem Haushalt als Wirtschafterin arbeitet und dort Unfug treibt. Der Ton ist unbeschwert und humorvoll, was durch die eingängige Reimstruktur und die flapsige Sprache verstärkt wird. Die ersten beiden Strophen etablieren die Ausgangssituation und die ersten Vergehen der Wirtschafterin. Sie versalzt die Suppe, „vergisst“ die Sommerzeit und stiehlt sogar Silberlöffel und Bargeld. Bemerkenswert ist, dass der Mann, der sie eingestellt hat, zunächst nicht verärgert oder entrüstet reagiert, sondern sie sogar mit schmeichelhaften Worten anspricht.
Die zweite Hälfte des Gedichts dreht die Schraube noch ein Stück weiter. In der dritten Strophe wird die Wirtschafterin immer dreister, sie „heizt“ den Mann mit leeren Versprechungen ein. Der Höhepunkt und zugleich die Pointe des Gedichts findet sich in der letzten Strophe. Hier gesteht die Wirtschafterin, dass sie den Mann „angeschissen“ hat, eine drastische und umgangssprachliche Formulierung, die ihre Respektlosigkeit und den Grad ihres Betrugs unterstreicht. Interessanterweise wird ihre Entlassung nicht als Strafe, sondern als Höhepunkt der „wundervollen Zeit“ betrachtet, was die ironische und subversive Natur des Gedichts verdeutlicht.
Die Kernbotschaft des Gedichts ist eine spielerische Umkehrung der traditionellen Rollenbilder und Erwartungen. Die Frau, die in der Rolle der Dienerin agiert, nutzt ihre Position, um den Mann zu betrügen und zu manipulieren. Die scheinbar harmlose Erzählweise verbirgt eine Kritik an gesellschaftlichen Konventionen und Machtverhältnissen. Klabund spielt mit der Erwartung des Lesers, dass die Verfehlungen der Wirtschafterin bestraft werden, und bricht diese Erwartung, indem er das Ende als „wundervolle Zeit“ feiert.
Der Reiz des Gedichts liegt in seinem subversiven Humor und seiner Unkonventionalität. Klabund wählt eine ungewöhnliche Perspektive und präsentiert eine Geschichte, die sowohl amüsant als auch provokant ist. Die lockere Sprache und die rhythmische Struktur machen das Gedicht leicht zugänglich und einprägsam. Es ist ein Paradebeispiel für Klabunds Talent, mit Ironie und Wortwitz gesellschaftliche Konventionen aufs Korn zu nehmen und dabei gleichzeitig eine humorvolle und unterhaltsame Geschichte zu erzählen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.