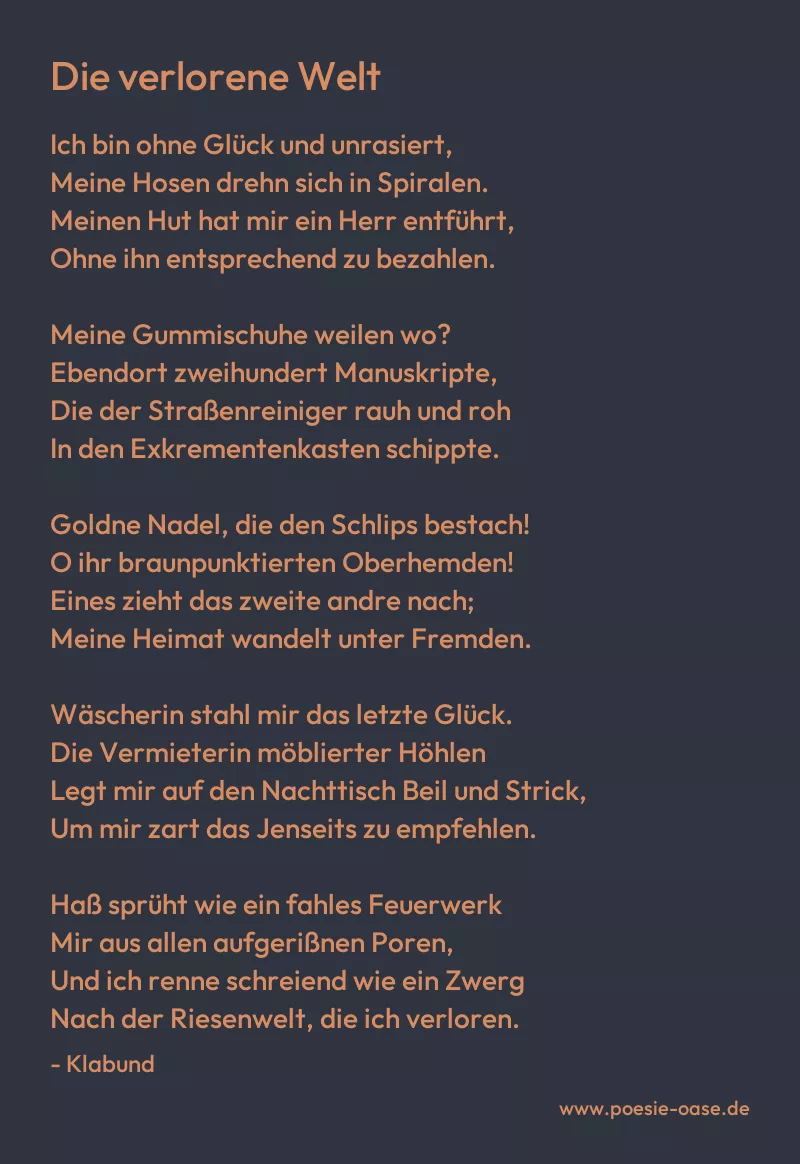Die verlorene Welt
Ich bin ohne Glück und unrasiert,
Meine Hosen drehn sich in Spiralen.
Meinen Hut hat mir ein Herr entführt,
Ohne ihn entsprechend zu bezahlen.
Meine Gummischuhe weilen wo?
Ebendort zweihundert Manuskripte,
Die der Straßenreiniger rauh und roh
In den Exkrementenkasten schippte.
Goldne Nadel, die den Schlips bestach!
O ihr braunpunktierten Oberhemden!
Eines zieht das zweite andre nach;
Meine Heimat wandelt unter Fremden.
Wäscherin stahl mir das letzte Glück.
Die Vermieterin möblierter Höhlen
Legt mir auf den Nachttisch Beil und Strick,
Um mir zart das Jenseits zu empfehlen.
Haß sprüht wie ein fahles Feuerwerk
Mir aus allen aufgerißnen Poren,
Und ich renne schreiend wie ein Zwerg
Nach der Riesenwelt, die ich verloren.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
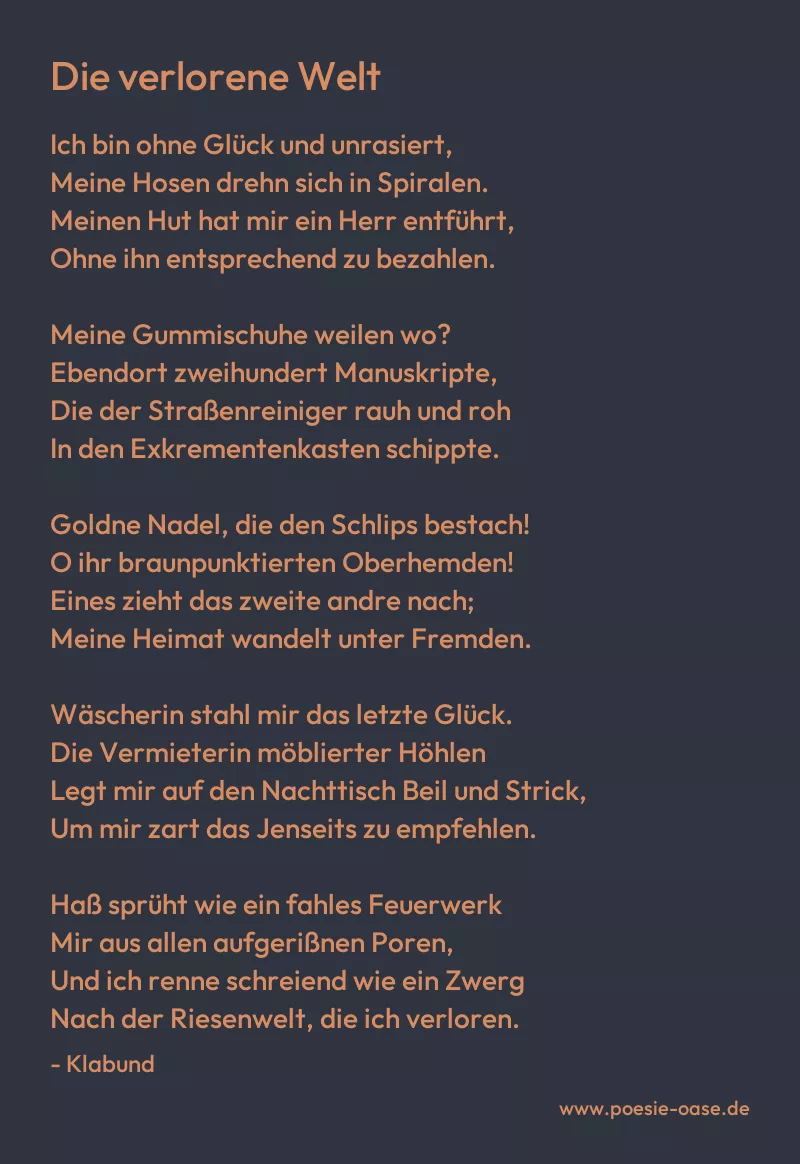
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die verlorene Welt“ von Klabund zeichnet ein düsteres Bild der persönlichen und gesellschaftlichen Zerrissenheit. Der Sprecher befindet sich in einer tiefen Krise, charakterisiert durch äußere Verwahrlosung (unrasiert, zerlumpte Kleidung) und innere Verzweiflung. Die verlorene Welt bezieht sich nicht nur auf materielle Güter, sondern auch auf ein Gefühl von Heimat, Glück und Sinn. Der Verlust manifestiert sich in fast jedem Aspekt des Lebens, von banalen Dingen wie dem Hut bis hin zu existenziellen Fragen nach Identität und Zugehörigkeit.
Die Sprache des Gedichts ist von einer Mischung aus Ironie und Verzweiflung geprägt. Die Aufzählung der verlorenen Besitztümer und die skurrile Beschreibung des Diebstahls des Huts kontrastieren mit der tiefer liegenden Tragik. Die Metaphern sind eindringlich und verstärken das Gefühl der Hoffnungslosigkeit: Die Hosen drehen sich in Spiralen, die Manuskripte landen im Müll, und die „goldne Nadel“ und das „braunpunktierte Oberhemd“ stehen für verblassten Glanz. Der Hass, der aus dem Sprecher herausschießt, ist wie ein „fahles Feuerwerk“, ein kurzes, aber intensives Aufblitzen von Wut und Enttäuschung.
Die dritte Strophe verdeutlicht den Verlust der Heimat und die Entfremdung des Sprechers. „Meine Heimat wandelt unter Fremden“ suggeriert, dass der Sprecher sich in seiner eigenen Welt verloren hat und von ihr entfremdet ist. Diese Zeilen evozieren ein Gefühl von Isolation und dem Verlust von Vertrautheit und Zugehörigkeit. Die Wäscherin, die das „letzte Glück“ stiehlt, und die Vermieterin, die Werkzeuge für den Selbstmord bereithält, verstärken das Bild der Hoffnungslosigkeit und des Verrats.
Das Gedicht endet mit einem Ausbruch von Zorn und Verzweiflung. Der Sprecher rennt „schreiend wie ein Zwerg“ nach der „Riesenwelt“, die er verloren hat. Dieser Schrei ist ein Zeichen der Sehnsucht nach etwas Größerem, nach einer besseren Welt, die unerreichbar scheint. Die „Riesenwelt“ kann als Ideal, als ein Zustand von Glück, Sinn und Harmonie interpretiert werden, der dem Sprecher verwehrt bleibt. Das Gedicht ist somit eine klagende Reflexion über den Verlust, die Entfremdung und die Sinnsuche in einer als trostlos empfundenen Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.