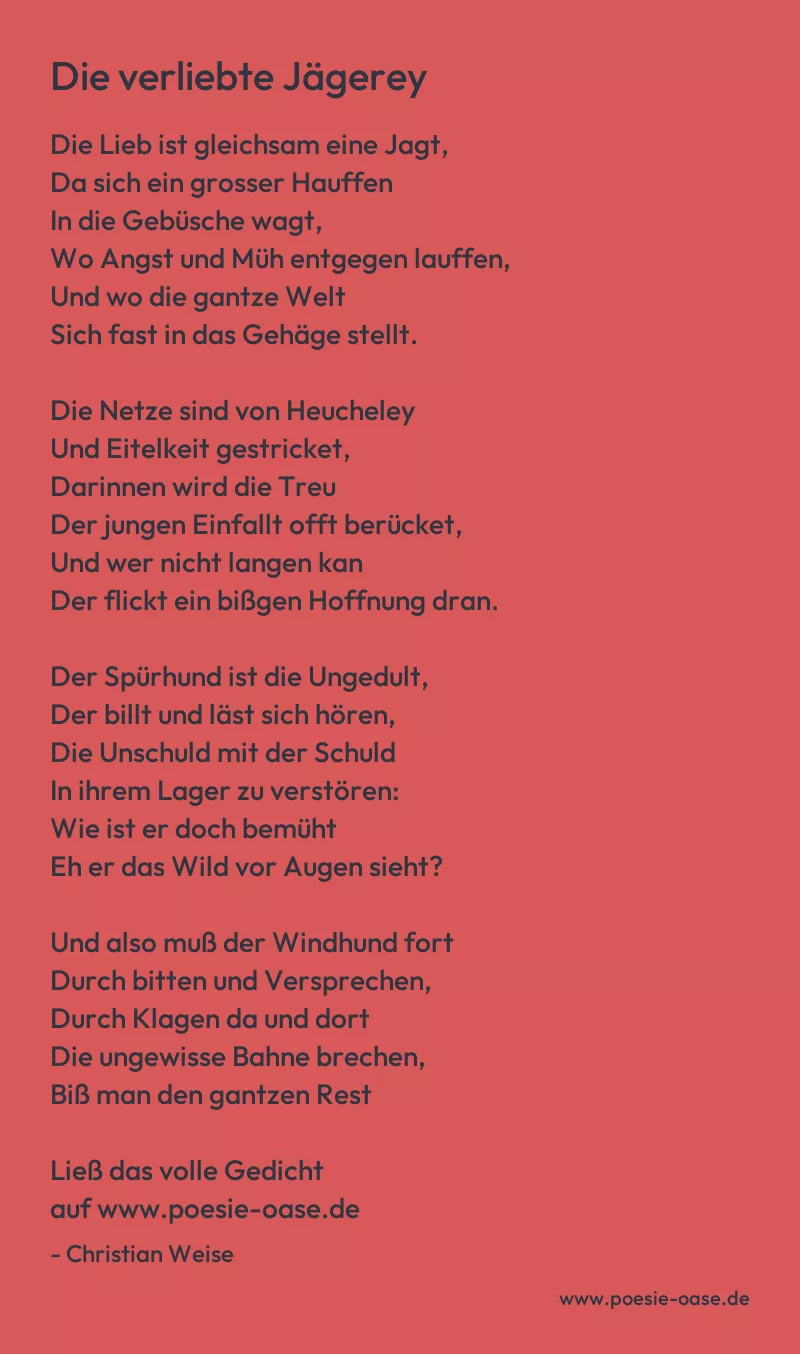Die verliebte Jägerey
Die Lieb ist gleichsam eine Jagt,
Da sich ein grosser Hauffen
In die Gebüsche wagt,
Wo Angst und Müh entgegen lauffen,
Und wo die gantze Welt
Sich fast in das Gehäge stellt.
Die Netze sind von Heucheley
Und Eitelkeit gestricket,
Darinnen wird die Treu
Der jungen Einfallt offt berücket,
Und wer nicht langen kan
Der flickt ein bißgen Hoffnung dran.
Der Spürhund ist die Ungedult,
Der billt und läst sich hören,
Die Unschuld mit der Schuld
In ihrem Lager zu verstören:
Wie ist er doch bemüht
Eh er das Wild vor Augen sieht?
Und also muß der Windhund fort
Durch bitten und Versprechen,
Durch Klagen da und dort
Die ungewisse Bahne brechen,
Biß man den gantzen Rest
Der grossen Docken lauffen läst.
Oft schiest man Ehr und Tugend todt,
Dann die verliebten Minen
Sind wie der Haasenschrot:
Wohl denen die sich so bedienen!
Denn wer ein Narr will seyn,
Schiest gar mit silbern Kugeln drein.
Wiewohl manch armer Jäger sagt
Er hab es gut erlesen,
Und hab ein Reh gejagt,
So ist es kaum ein Fuchs gewesen:
Und wer den Hirschen hetzt,
Nimmt wol ein Eichhorn auff die letzt.
Offt setzt ein Hauer seinen Zahn
In die getroffne Liebe
Mit solchem Eyver an,
Daß alle Gunst in einem Hiebe
Zu Grund und Boden geht,
Und wenn sie noch so feste steht.
Doch geht, ihr Freunde, geht ins Feld,
Habt ihr mit euren Netzen
Schon einmahl auffgestellt,
So seid ihrs schuldig fortzusetzen:
Denn der ist übel dran
Der hetzen und nicht fangen kan.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
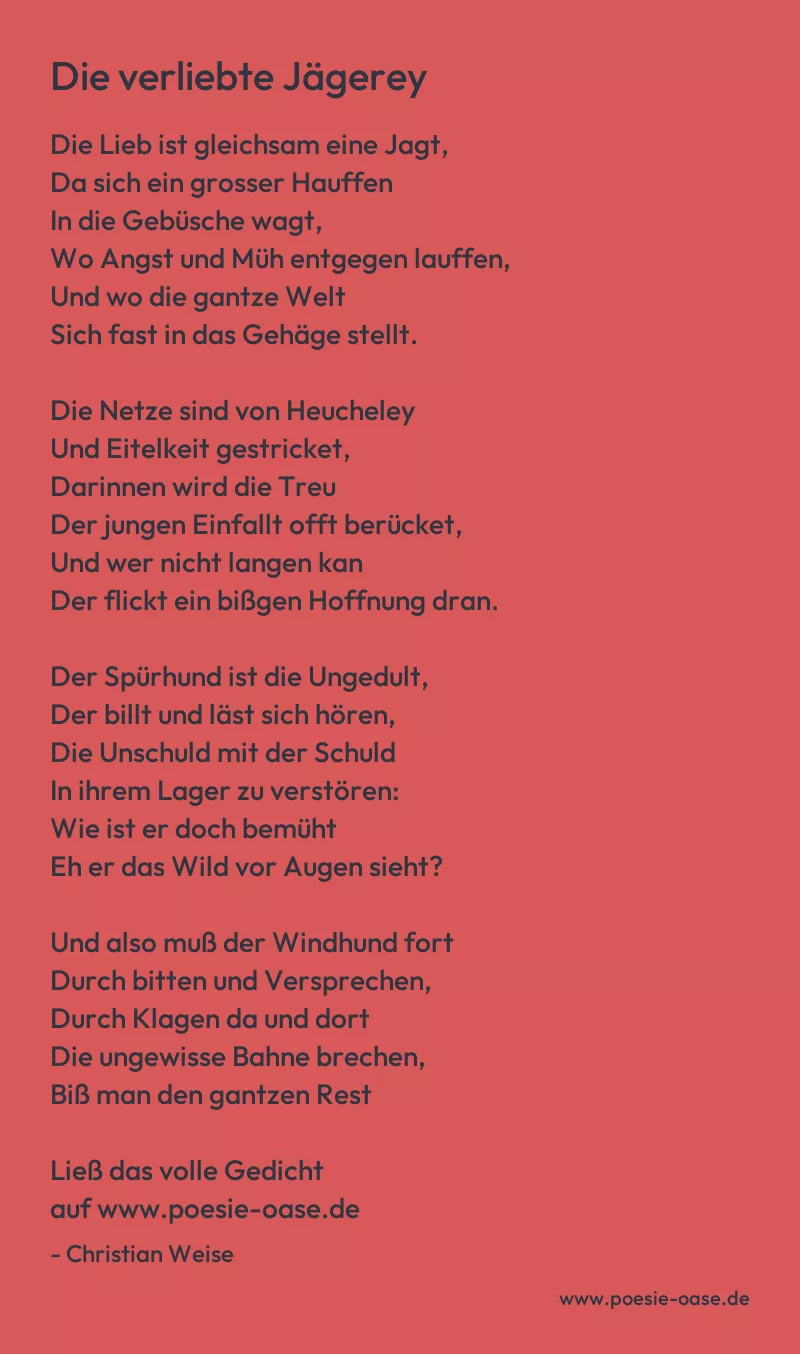
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die verliebte Jägerey“ von Christian Weise ist eine allegorische Darstellung der Liebe als Jagd, die mit einer Reihe von Metaphern und Bildern das Wesen des Verliebtseins, die damit verbundenen Herausforderungen und die potenziellen Ergebnisse untersucht. Das Gedicht beginnt mit der Feststellung, dass die Liebe einer Jagd gleicht, bei der eine große Menge von Menschen in die „Gebüsche“ geht, wo Angst und Mühe herrschen. Diese Eröffnung etabliert den Kampfcharakter der Liebe und deutet auf die Schwierigkeiten und die Mühen hin, die mit der Verfolgung verbunden sind.
In den darauffolgenden Strophen werden verschiedene Elemente der Jagd als Metaphern für die Liebe verwendet. „Die Netze sind von Heucheley / Und Eitelkeit gestricket“, wodurch die Täuschung und die Oberflächlichkeit, die die Liebe oft begleiten, hervorgehoben werden. Die „Ungedult“ wird als Spürhund beschrieben, der versucht, die „Unschuld“ zu stören. Weiterhin beschreibt das Gedicht die Strategien, die die Jäger einsetzen, wie etwa Bitten, Versprechen und Klagen, um ihren „Windhund“ (die Emotionen) durch die „ungewisse Bahne“ zu führen. Die Metaphern veranschaulichen die List, die Hartnäckigkeit und die oft betrügerische Natur, die im Werben um Liebe zum Tragen kommt.
Die späteren Strophen schlagen einen ernsteren Ton an und untersuchen die Konsequenzen des Liebeskampfes. „Oft schiest man Ehr und Tugend todt“, wodurch die zerstörerische Kraft der Liebe, insbesondere wenn sie ungestüm und ungezügelt ist, betont wird. Das Gedicht warnt vor dem Risiko, die wahre Liebe zu verfehlen, indem es die Jagd nach geringeren Zielen, wie etwa dem „Fuchs“ anstelle des „Rehs“, beschreibt. Die letzte Strophe, die mit einem Appell an die „Freunde“ endet, ermutigt die Leser, ihre Jagd fortzusetzen, selbst angesichts von Widrigkeiten, da diejenigen, die sich dem Kampf nicht stellen, am Ende nicht erfolgreich sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gedicht eine komplexe Sichtweise der Liebe bietet, indem es sie als einen Kampf darstellt, der von Täuschung, Anstrengung und der Gefahr von Verlust geprägt ist. Durch die Verwendung von Bildern der Jagd macht Weise die Komplexität und die Herausforderungen des Verliebtseins deutlich. Das Gedicht bietet sowohl eine Warnung vor den Fallstricken der Liebe als auch eine Ermutigung, sich dem Kampf zu stellen und ihn mit Ausdauer fortzusetzen. Es zeigt, dass Liebe sowohl als lohnende Erfahrung als auch als Quelle von Schmerz und Enttäuschung erlebt werden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.