Wehe, mein Vaterland, dir! Das Lied dir zum Ruhme zu singen,
Ist, getreu dir im Schoß, mir, deinem Dichter, verwehrt!
Die tiefste Erniedrigung
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
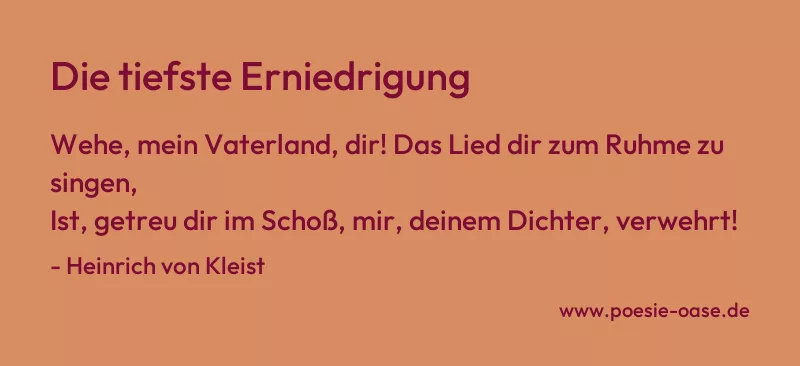
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die tiefste Erniedrigung“ von Heinrich von Kleist drückt in wenigen, eindringlichen Zeilen die tiefe Verzweiflung und den Schmerz des Dichters über die erlebte politische Erniedrigung seines Vaterlandes aus. Die zwei Verse vermitteln einen Zustand der Hoffnungslosigkeit und des Zwangs, der die kreative Freiheit des Dichters einschränkt.
Die zentrale Aussage des Gedichts liegt im ersten Vers: „Wehe, mein Vaterland, dir!“. Dieses „Wehe“ ist ein Ausdruck tiefster Betroffenheit und Trauer, ein Klageruf über das Schicksal des Vaterlandes. Es signalisiert eine negative Entwicklung, ein Unglück, das über das Land gekommen ist. Der zweite Teil des Verses, „Das Lied dir zum Ruhme zu singen“, verdeutlicht die Absicht des Dichters, sein Land in Ehren zu besingen, es zu preisen und zu rühmen. Dies wird jedoch durch die im zweiten Vers beschriebene Realität vereitelt.
Der zweite Vers, „Ist, getreu dir im Schoß, mir, deinem Dichter, verwehrt!“, erklärt die Ursache für das „Wehe“. Hier wird klar, dass die Treue zum Vaterland, die innige Verbundenheit des Dichters, ihn paradoxerweise an der Erfüllung seiner dichterischen Pflicht hindert. Die Zeile suggeriert, dass die politischen Umstände so verheerend sind, dass der Dichter nicht mehr imstande ist, ein Loblied auf sein Land zu verfassen. Die „tiefe Erniedrigung“ des Titels ist somit nicht nur eine Erfahrung des Vaterlandes, sondern auch des Dichters, der in seinem Schaffen eingeschränkt wird.
Insgesamt ist das Gedicht ein Ausdruck von Patriotismus, der durch politische Umstände in seine Schranken gewiesen wird. Es zeugt von der Ohnmacht des Dichters angesichts der Ereignisse und verdeutlicht die Zerstörung der kulturellen und künstlerischen Freiheit durch politische Unterdrückung oder Erniedrigung. Die Kürze des Gedichts verstärkt seine Wirkung, indem es die Intensität der Gefühle und die Unmöglichkeit, die Situation zu beschönigen, hervorhebt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
