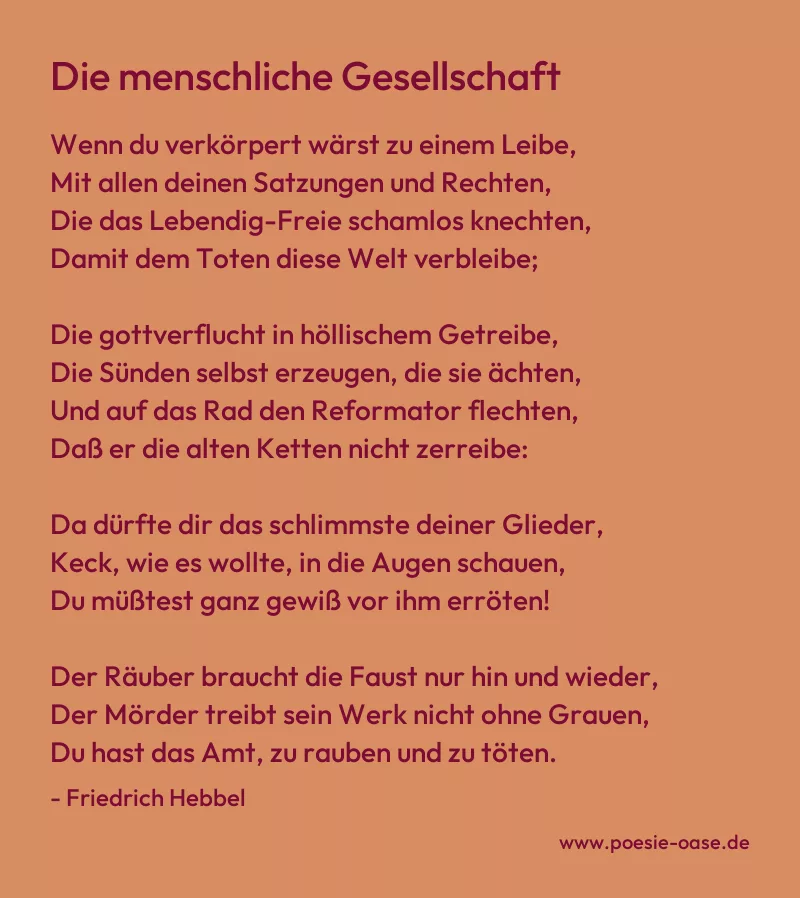Die menschliche Gesellschaft
Wenn du verkörpert wärst zu einem Leibe,
Mit allen deinen Satzungen und Rechten,
Die das Lebendig-Freie schamlos knechten,
Damit dem Toten diese Welt verbleibe;
Die gottverflucht in höllischem Getreibe,
Die Sünden selbst erzeugen, die sie ächten,
Und auf das Rad den Reformator flechten,
Daß er die alten Ketten nicht zerreibe:
Da dürfte dir das schlimmste deiner Glieder,
Keck, wie es wollte, in die Augen schauen,
Du müßtest ganz gewiß vor ihm erröten!
Der Räuber braucht die Faust nur hin und wieder,
Der Mörder treibt sein Werk nicht ohne Grauen,
Du hast das Amt, zu rauben und zu töten.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
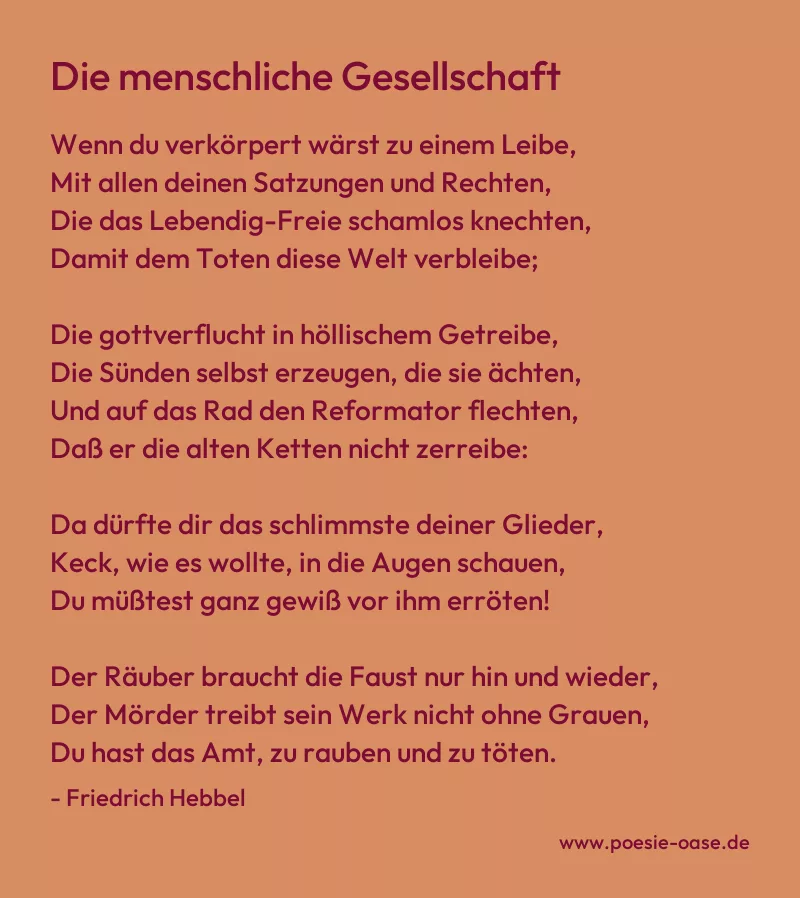
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die menschliche Gesellschaft“ von Friedrich Hebbel ist eine scharfe und bittere Anklage gegen die gesellschaftlichen Strukturen und deren verheerende Auswirkungen auf den Einzelnen. Es entlarvt die Heuchelei und die Selbstzerstörungstendenzen der Gesellschaft, indem es sie als einen moralisch verkommenen Körper darstellt. Die Metapher des „Leibes“ dient als Ausgangspunkt, um die Widersprüchlichkeiten und die Verfehlungen der Gesellschaft aufzuzeigen.
Die ersten acht Verse, also die beiden Quartette, zeichnen ein düsteres Bild einer Gesellschaft, die durch ihre Gesetze und Regeln das freie Leben unterdrückt und letztendlich das Tote bevorzugt. Die „Satzungen und Rechte“ werden als Instrumente der Knechtschaft dargestellt, die das Lebendige „schamlos knechten“. Die Gesellschaft wird als ein „höllisches Getreibe“ beschrieben, das paradoxerweise die Sünden hervorbringt, die es verurteilt. Dies verdeutlicht die Selbstzerstörungstendenzen und die moralische Verkommenheit, die Hebbel in der Gesellschaft wahrnimmt. Die Anspielung auf den „Reformator“ und das „Rad“ deutet auf die Unterdrückung jeglicher Veränderung und Innovation hin, ein klares Zeichen für die konservative Natur der Gesellschaft, die sich gegen jede Form von Freiheit wehrt.
In den letzten sechs Versen, den beiden Terzetten, wird die Kritik noch zugespitzter. Hier wird die Gesellschaft mit einem moralisch verwerflichen Menschen verglichen, der sich für seine Untaten schämen müsste. Der Vergleich des „schlimmste[n] deiner Glieder“ mit den Augen, die frech die Gesellschaft anblicken, zeigt die innere Zerrissenheit und die moralische Verkommenheit der Gesellschaft. Die Gesellschaft, repräsentiert durch dieses „schlimmste Glied“, müsste vor sich selbst erröten, wenn sie ihre eigenen Taten und Verfehlungen betrachtet.
Die abschließenden Zeilen verstärken die Kritik noch. Während Räuber und Mörder nur gelegentlich oder mit „Grauen“ handeln, hat die Gesellschaft „das Amt, zu rauben und zu töten“. Hier wird die Gesellschaft als institutionelle Räuberin und Mörderin entlarvt, die durch ihre Strukturen und Praktiken Leid und Zerstörung verursacht. Hebbel kehrt hier die übliche Moral um: Während Raub und Mord normalerweise als Verbrechen angesehen werden, deutet er an, dass die Gesellschaft in ihren eigenen Strukturen solche Handlungen institutionalisiert und legitimiert, wodurch sie zu etwas noch Verwerflicherem wird. Das Gedicht ist somit eine schonungslose Abrechnung mit den gesellschaftlichen Zwängen und eine Anklage gegen die Heuchelei und die moralische Verkommenheit der menschlichen Gesellschaft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.