Dieser Roman ist nicht für dich, meine Tochter. In Ohnmacht!
Schamlose Posse! Sie hielt, weiß ich, die Augen bloß zu.
Die Marquise von O …
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
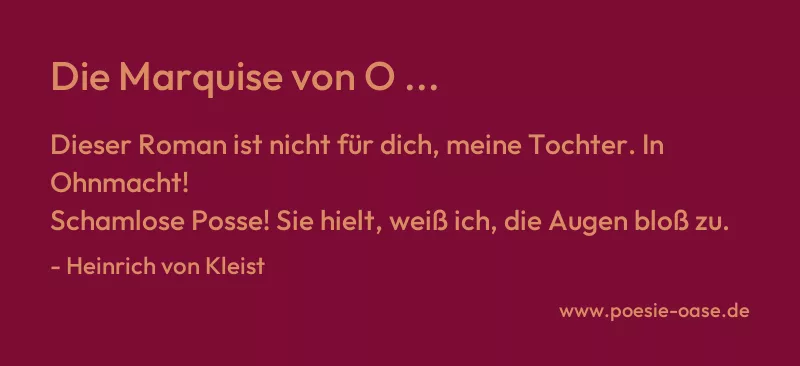
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Marquise von O …“ von Heinrich von Kleist, hier in Form eines Fragmentes, präsentiert sich als eine fragmentarische Reaktion auf einen Roman. Der Autor spricht direkt eine „Tochter“ an und spricht damit eine Intimität an, die durch die klare Abweisung des Werkes verstärkt wird. Der kurze Text ist aufgeladen mit Emotionen und einer indirekten Kritik, die mehr erahnen lässt, als sie explizit ausspricht.
Die Verwendung von Ausrufen wie „In Ohnmacht!“ und „Schamlose Posse!“ deutet auf einen tiefen emotionalen Aufruhr des Sprechers hin. Diese Ausdrücke signalisieren Empörung und Ablehnung gegenüber dem Roman, der in ihrer „Tochter“ eine Ohnmacht ausgelöst haben muss. Das Wort „Posse“ deutet darauf hin, dass der Sprecher den Roman als trivial oder sogar obszön empfindet, was seine Ablehnung noch verstärkt. Die Kürze des Gedichts – es besteht nur aus zwei Sätzen – intensiviert die Wirkung, da die verletzliche Reaktion auf das Gelesene direkt zum Ausdruck gebracht wird.
Der zweite Satz „Sie hielt, weiß ich, die Augen bloß zu“ fügt der Interpretation eine weitere Ebene hinzu. Hier wird die Perspektive der Tochter kurz angedeutet. Die Formulierung suggeriert, dass die Tochter das Gelesene als unangenehm oder verstörend empfand und versuchte, sich ihm durch das Schließen der Augen zu entziehen. Dies kann als eine Geste der Scham, des Unverständnisses oder der Überforderung interpretiert werden. Der Sprecher scheint die Reaktion der Tochter zu kennen oder zu erwarten, was auf eine gemeinsame Beziehung oder eine gewisse Vertrautheit hindeutet.
Insgesamt ist das Gedicht ein eindringliches Porträt einer elterlichen Reaktion auf einen Roman, der als anstößig empfunden wird. Es ist ein Appell der Fürsorge und ein Ausdruck des Schutzes, gerichtet an die Tochter, die der Sprecher vor den vermeintlichen Gefahren des Werkes bewahren möchte. Durch die Kürze, die Emotionalität und die indirekte Erzählweise erzeugt Kleist eine intensive Atmosphäre, die den Leser dazu anregt, über die Gründe für die Ablehnung des Romans und die Natur der Beziehung zwischen dem Sprecher und seiner Tochter nachzudenken. Das Gedicht ist in seiner fragmentarischen Form eine Momentaufnahme, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet, und dadurch eine bleibende Wirkung erzielt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
