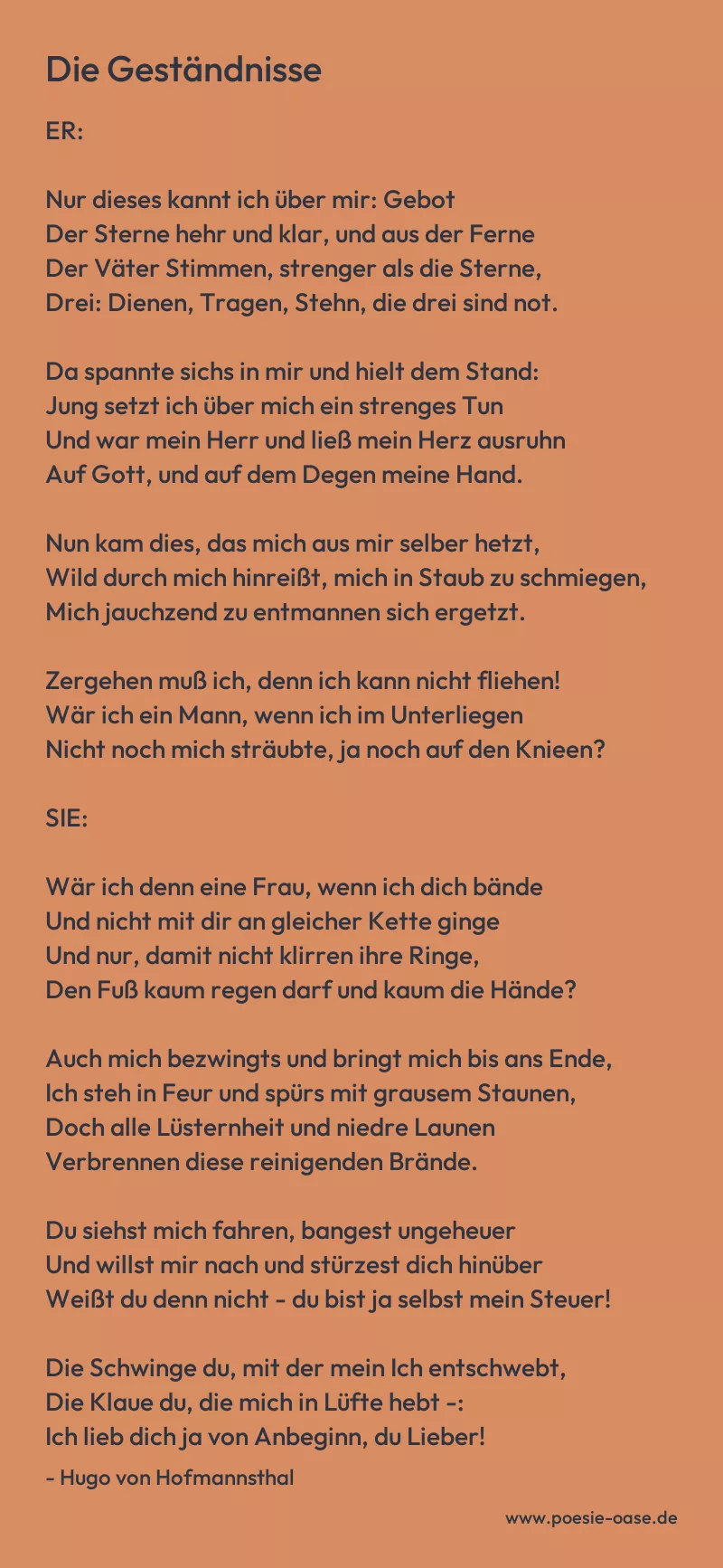Die Geständnisse
ER:
Nur dieses kannt ich über mir: Gebot
Der Sterne hehr und klar, und aus der Ferne
Der Väter Stimmen, strenger als die Sterne,
Drei: Dienen, Tragen, Stehn, die drei sind not.
Da spannte sichs in mir und hielt dem Stand:
Jung setzt ich über mich ein strenges Tun
Und war mein Herr und ließ mein Herz ausruhn
Auf Gott, und auf dem Degen meine Hand.
Nun kam dies, das mich aus mir selber hetzt,
Wild durch mich hinreißt, mich in Staub zu schmiegen,
Mich jauchzend zu entmannen sich ergetzt.
Zergehen muß ich, denn ich kann nicht fliehen!
Wär ich ein Mann, wenn ich im Unterliegen
Nicht noch mich sträubte, ja noch auf den Knieen?
SIE:
Wär ich denn eine Frau, wenn ich dich bände
Und nicht mit dir an gleicher Kette ginge
Und nur, damit nicht klirren ihre Ringe,
Den Fuß kaum regen darf und kaum die Hände?
Auch mich bezwingts und bringt mich bis ans Ende,
Ich steh in Feur und spürs mit grausem Staunen,
Doch alle Lüsternheit und niedre Launen
Verbrennen diese reinigenden Brände.
Du siehst mich fahren, bangest ungeheuer
Und willst mir nach und stürzest dich hinüber
Weißt du denn nicht – du bist ja selbst mein Steuer!
Die Schwinge du, mit der mein Ich entschwebt,
Die Klaue du, die mich in Lüfte hebt -:
Ich lieb dich ja von Anbeginn, du Lieber!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
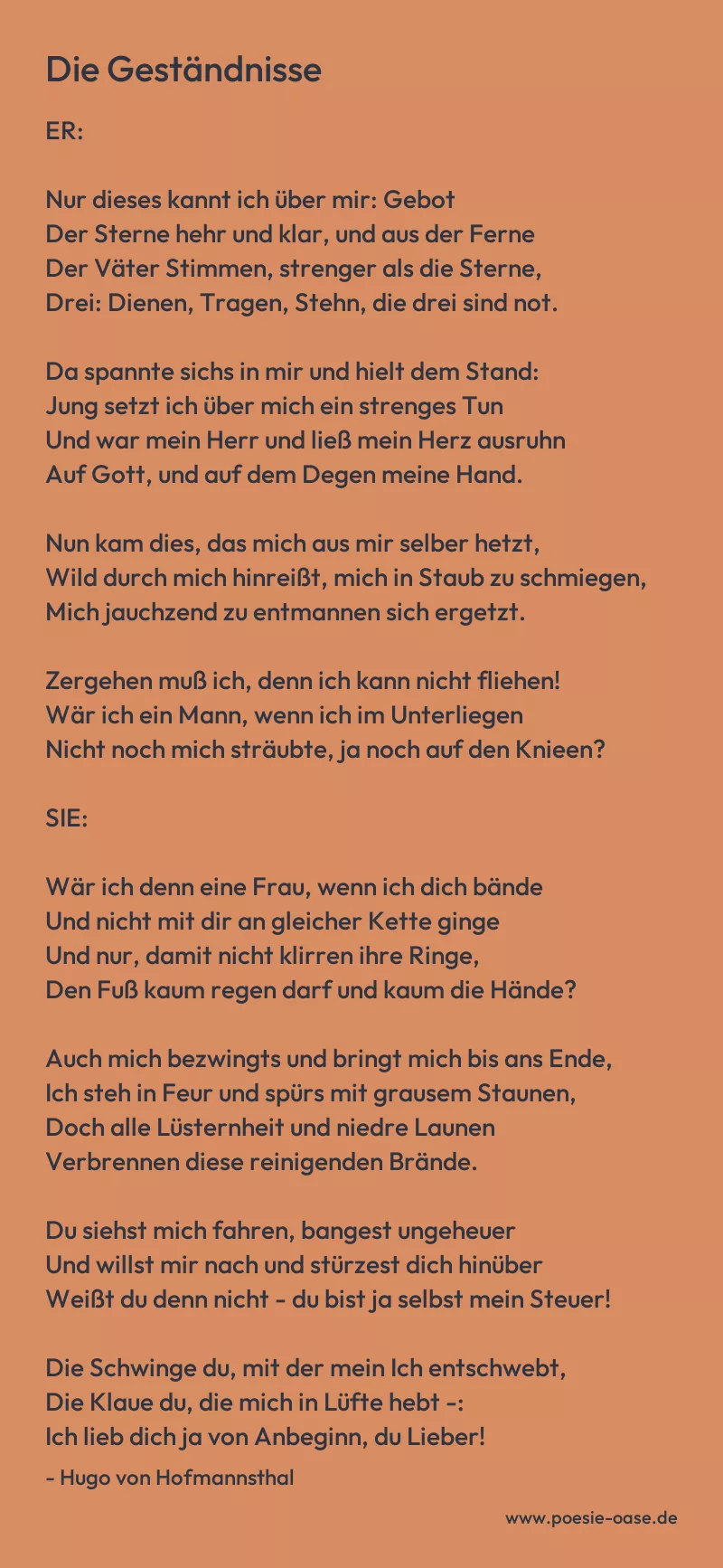
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Geständnisse“ von Hugo von Hofmannsthal ist ein Dialog, der die innere Zerrissenheit zweier Liebender angesichts der alles verändernden Macht der Leidenschaft thematisiert. Es eröffnet mit der männlichen Perspektive, in der er zunächst eine von Pflicht und Disziplin geprägte Lebenshaltung beschreibt, in der die Werte von „Dienen, Tragen, Stehn“ bestimmend waren. Diese Haltung, getragen von „Gebot der Sterne“ und „Väter Stimmen“, wird als ein strenges, aber geordnetes Leben dargestellt, in dem er sich selbst zum „Herrn“ machte und sein Herz „auf Gott“ ausruhen ließ. Die Erwähnung des „Degen“ symbolisiert dabei die Stärke und Selbstbeherrschung des Mannes.
Die zweite Strophe des Mannes beschreibt den jähen Umschwung, der ihn aus dieser Ordnung reißt: ein Gefühl, das ihn „aus mir selber hetzt“ und ihn in einen Zustand der Auflösung und Hingabe versetzt. Dieses „Wild“ und ungestüme Gefühl, die alles verändernde Leidenschaft, wird als etwas dargestellt, dem er sich nicht entziehen kann. Die Sprache ist von starker Emotionalität geprägt, was die innere Zerrissenheit und das Gefühl des Verlustes von Kontrolle verdeutlicht. Die Zeile „Zergehen muss ich, denn ich kann nicht fliehen!“ drückt die Hilflosigkeit und das Unvermeidliche der Situation aus, die in den letzten beiden Versen, die die Frage nach seiner Männlichkeit aufwerfen, ihren Höhepunkt findet.
Der zweite Teil des Gedichts, die Perspektive der Frau, spiegelt diese Gefühlswelt wider, indem sie die gleiche emotionale Zerrissenheit und das Überwältigtsein durch die Liebe beschreibt. Auch sie spürt eine unbändige Kraft, die sie „bis ans Ende“ bringt. Im Gegensatz zur anfänglichen Selbstbeherrschung des Mannes, nimmt die Frau die Rolle der Gleichberechtigten ein, die sich der Leidenschaft hingibt und die Auflösung, die für den Mann bedrohlich war, als reinigende Kraft erlebt. Sie stellt klar, dass sie sich ihm mit aller Hingabe anschließt.
Die abschließenden Verse der Frau kehren die Rollen um: Sie ist das „Steuer“ und die „Schwinge“, der er folgt und durch die er sich selbst neu erfindet. Dies unterstreicht das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis und die allumfassende Macht der Liebe, die beide in ein neues, gemeinsames Sein verwandelt. Das Gedicht endet mit einer Erklärung der Liebe „von Anbeginn“, wodurch die Ewigkeit und Unvermeidlichkeit der Beziehung betont werden. Somit stellt Hofmannsthal in diesem Gedicht die Zerrissenheit und die Hingabe, die mit der alles verändernden Macht der Liebe verbunden sind, auf eindrucksvolle Weise dar.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.