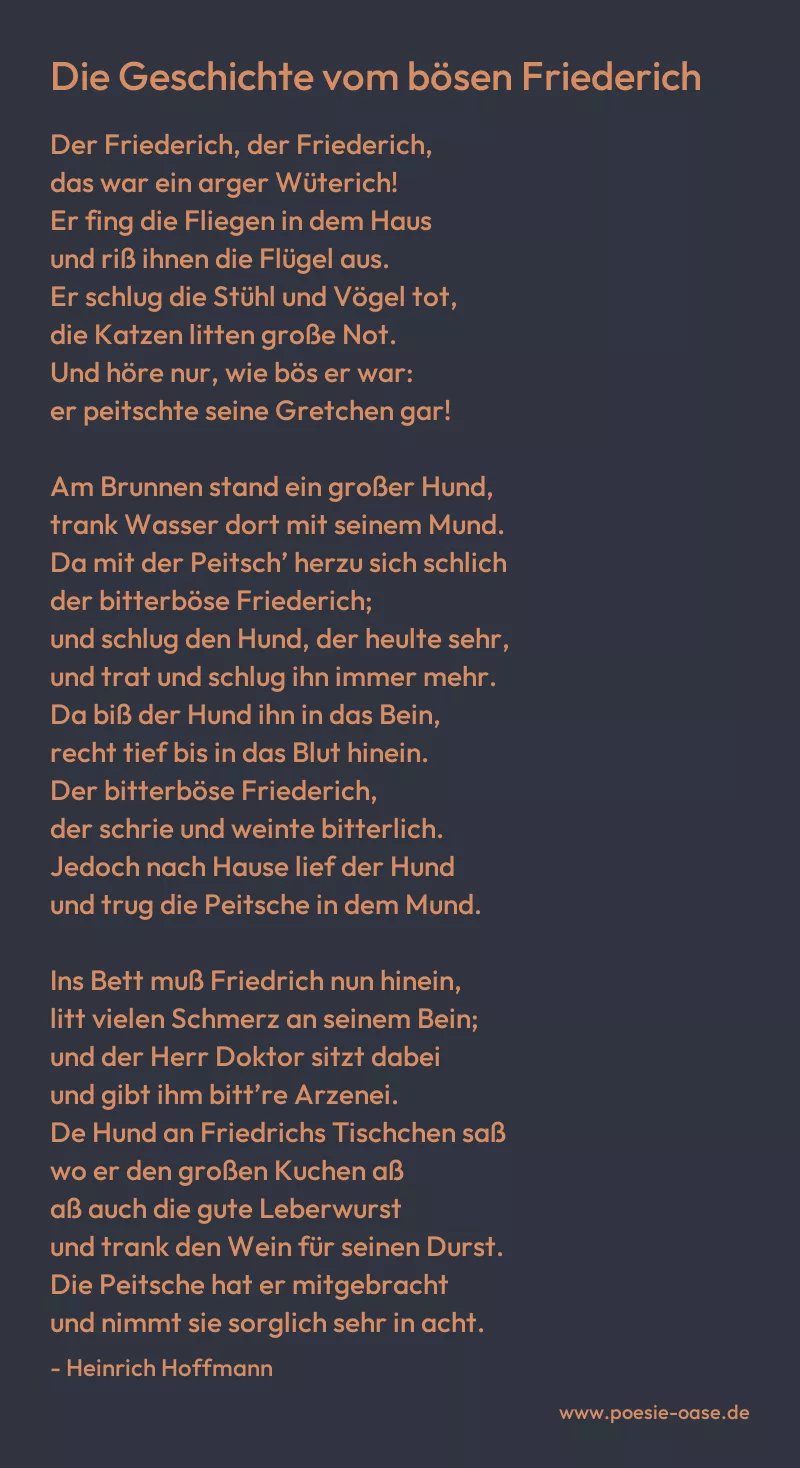Die Geschichte vom bösen Friederich
Der Friederich, der Friederich,
das war ein arger Wüterich!
Er fing die Fliegen in dem Haus
und riß ihnen die Flügel aus.
Er schlug die Stühl und Vögel tot,
die Katzen litten große Not.
Und höre nur, wie bös er war:
er peitschte seine Gretchen gar!
Am Brunnen stand ein großer Hund,
trank Wasser dort mit seinem Mund.
Da mit der Peitsch’ herzu sich schlich
der bitterböse Friederich;
und schlug den Hund, der heulte sehr,
und trat und schlug ihn immer mehr.
Da biß der Hund ihn in das Bein,
recht tief bis in das Blut hinein.
Der bitterböse Friederich,
der schrie und weinte bitterlich.
Jedoch nach Hause lief der Hund
und trug die Peitsche in dem Mund.
Ins Bett muß Friedrich nun hinein,
litt vielen Schmerz an seinem Bein;
und der Herr Doktor sitzt dabei
und gibt ihm bitt’re Arzenei.
De Hund an Friedrichs Tischchen saß
wo er den großen Kuchen aß
aß auch die gute Leberwurst
und trank den Wein für seinen Durst.
Die Peitsche hat er mitgebracht
und nimmt sie sorglich sehr in acht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
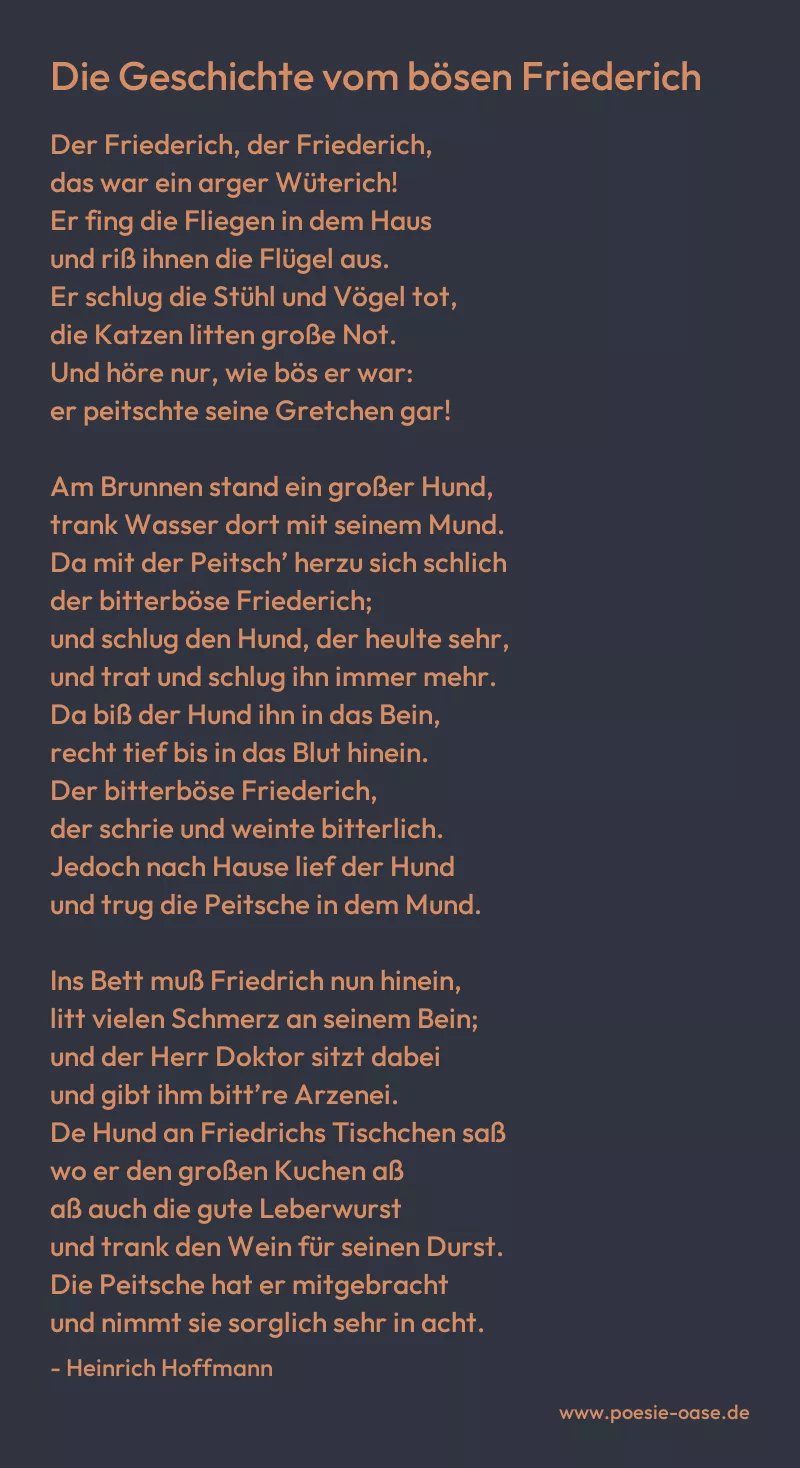
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Geschichte vom bösen Friederich“ von Heinrich Hoffmann ist eine moralisierende Erzählung, die durch einfache Sprache und drastische Bilder die Folgen von ungerechtfertigtem Verhalten und Gewalt veranschaulicht. Die Geschichte folgt der Figur des Friederich, eines kleinen Kindes, das durch sein bösartiges Verhalten Unheil anrichtet und letztendlich die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommt. Die Verwendung von einfachen Reimen und einem klaren Rhythmus, typisch für Kindergedichte, erleichtert das Verständnis der Moral und macht das Gedicht einprägsam für junge Leser.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt Friederichs sadistisches Verhalten gegenüber Tieren und der eigenen Schwester Gretchen. Er reißt Fliegen die Flügel aus, tötet Vögel und schlägt Katzen und Gretchen. Diese Darstellungen sind bewusst überzogen und sollen die Grausamkeit Friederichs hervorheben. Die Reaktionen der Tiere (und Gretchens) werden nicht explizit beschrieben, aber durch die Schilderung des Tuns Friederichs wird der Eindruck von Leid erzeugt. Der Leser wird dazu gebracht, Friederichs Verhalten zu verurteilen.
Der Wendepunkt des Gedichts ist die Begegnung mit dem Hund am Brunnen. Friederich, unverändert in seinem Verhalten, greift den Hund an, der sich daraufhin zur Wehr setzt und ihn beißt. Diese Szene stellt eine direkte Konsequenz für Friederichs vorheriges Verhalten dar und dient als zentrale Moral der Geschichte: Wer anderen Leid zufügt, muss mit ähnlichem Leid rechnen. Der Kontrast zwischen Friederichs anfänglicher Stärke und seinem anschließenden Weinen und Jammern unterstreicht die Ironie der Situation.
Im letzten Teil des Gedichts wird die gerechte Strafe für Friederich dargestellt, während der Hund, der zuvor Opfer seiner Grausamkeit war, die Früchte seines Erfolgs erntet. Friederich leidet unter Schmerzen und muss Medizin einnehmen, während der Hund am Tisch des Kindes speist und die Peitsche, das Symbol von Friederichs Macht, bewacht. Diese Umkehr der Rollen verdeutlicht die Botschaft des Gedichts nochmals: Gewalt erzeugt Gegengewalt, und die Opfer werden zu Siegern, während die Täter ihre gerechte Strafe erhalten. Die Geschichte dient somit als Warnung vor ungerechtfertigter Gewalt und Verhaltensauffälligkeiten und vermittelt die Idee von Karma im kindlichen Sinn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.