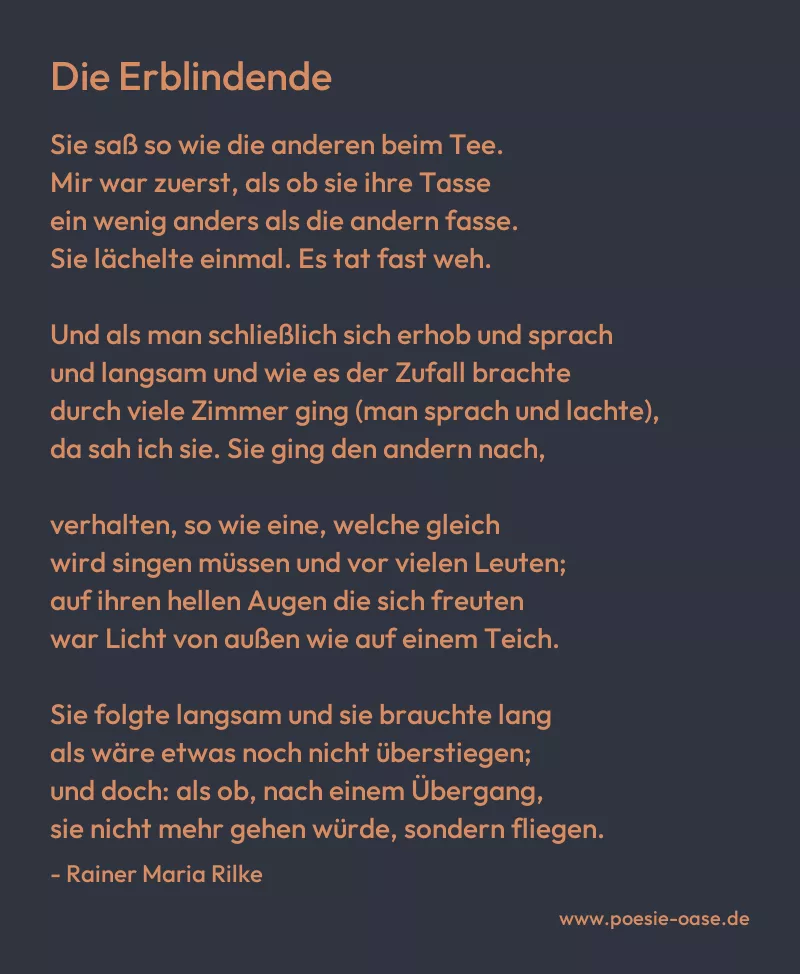Die Erblindende
Sie saß so wie die anderen beim Tee.
Mir war zuerst, als ob sie ihre Tasse
ein wenig anders als die andern fasse.
Sie lächelte einmal. Es tat fast weh.
Und als man schließlich sich erhob und sprach
und langsam und wie es der Zufall brachte
durch viele Zimmer ging (man sprach und lachte),
da sah ich sie. Sie ging den andern nach,
verhalten, so wie eine, welche gleich
wird singen müssen und vor vielen Leuten;
auf ihren hellen Augen die sich freuten
war Licht von außen wie auf einem Teich.
Sie folgte langsam und sie brauchte lang
als wäre etwas noch nicht überstiegen;
und doch: als ob, nach einem Übergang,
sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
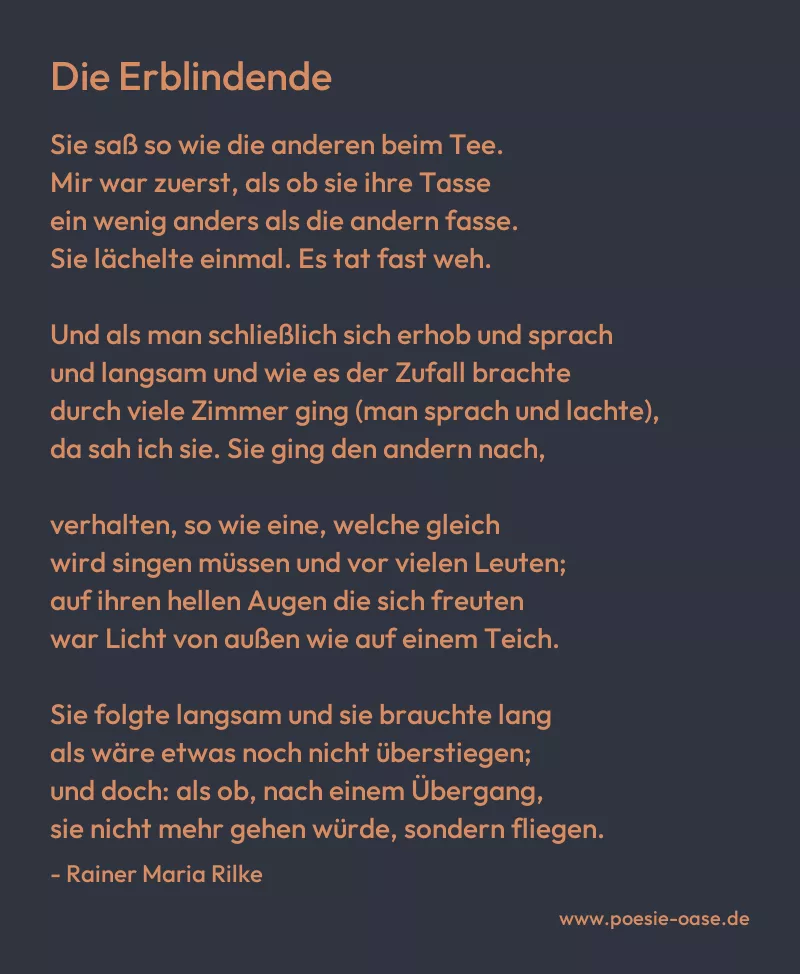
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Erblindende“ von Rainer Maria Rilke beschreibt eine Szene, in der der Erzähler eine Frau beobachtet, die sich von den anderen abhebt. Der Titel deutet bereits auf ein zentrales Thema hin: das allmähliche Erblinden, welches jedoch metaphorisch zu verstehen ist und nicht unbedingt eine physische Beeinträchtigung meint. Es geht vielmehr um einen inneren Prozess, eine Art Loslösung oder Veränderung, die sich in ihrem Verhalten und in der Wahrnehmung des Erzählers manifestiert.
Die ersten beiden Strophen etablieren die Ausgangssituation. Die Frau sitzt beim Tee, und der Erzähler bemerkt zunächst eine subtile Abweichung in ihrem Verhalten – eine leicht veränderte Art, die Tasse zu halten. Der Hinweis auf ein schmerzliches Lächeln deutet auf eine gewisse Verletzlichkeit oder Melancholie hin. Während des anschließenden Umhergehens in verschiedenen Zimmern wird die Frau vom Erzähler weiter beobachtet. Ihre Bewegung unterscheidet sich von den anderen; sie geht „verhalten“, als stünde ihr gleich eine ungewisse, öffentliche Darbietung bevor. Diese Metapher unterstreicht die Idee einer bevorstehenden Veränderung oder eines Übergangs.
Die dritte Strophe intensiviert die Beschreibung. Das Licht, das sich auf ihren Augen spiegelt, wird mit dem Licht auf einem Teich verglichen. Diese Metapher suggeriert eine Art Oberflächenerscheinung, die etwas über die Tiefe ihres Inneren verrät, gleichzeitig aber auch etwas von der Welt distanziert. Ihr Blick ist nach außen gerichtet, doch die Bedeutung liegt im Blick des Erzählers auf sie und ihrer Reaktion auf ihre Umwelt. Es wirkt, als trage sie eine Art Schutzschild oder zeige einen inneren Zustand, der sich in einer veränderten Wahrnehmung der äußeren Welt manifestiert.
Die abschließende Strophe verdichtet die Eindrücke. Die Frau benötigt „lang“, als gelte es, etwas noch nicht Überwundenes zu übersteigen. Der Schlussvers eröffnet eine überraschende Wendung: „sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen“. Dies deutet auf einen Zustand des Übergangs, der Transformation oder gar der Transzendenz hin. Das „Erblinden“ könnte somit als ein Loslassen der irdischen Beschränkungen interpretiert werden, eine Abkehr von der äußeren Welt und ein Hinwenden zu einer inneren Erfahrung, die von der des Erzählers nicht erfasst und definiert werden kann. Das Gedicht endet mit einer Ahnung, einem Gefühl des Nicht-Erfassbaren, das die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung und des Verstehens thematisiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.