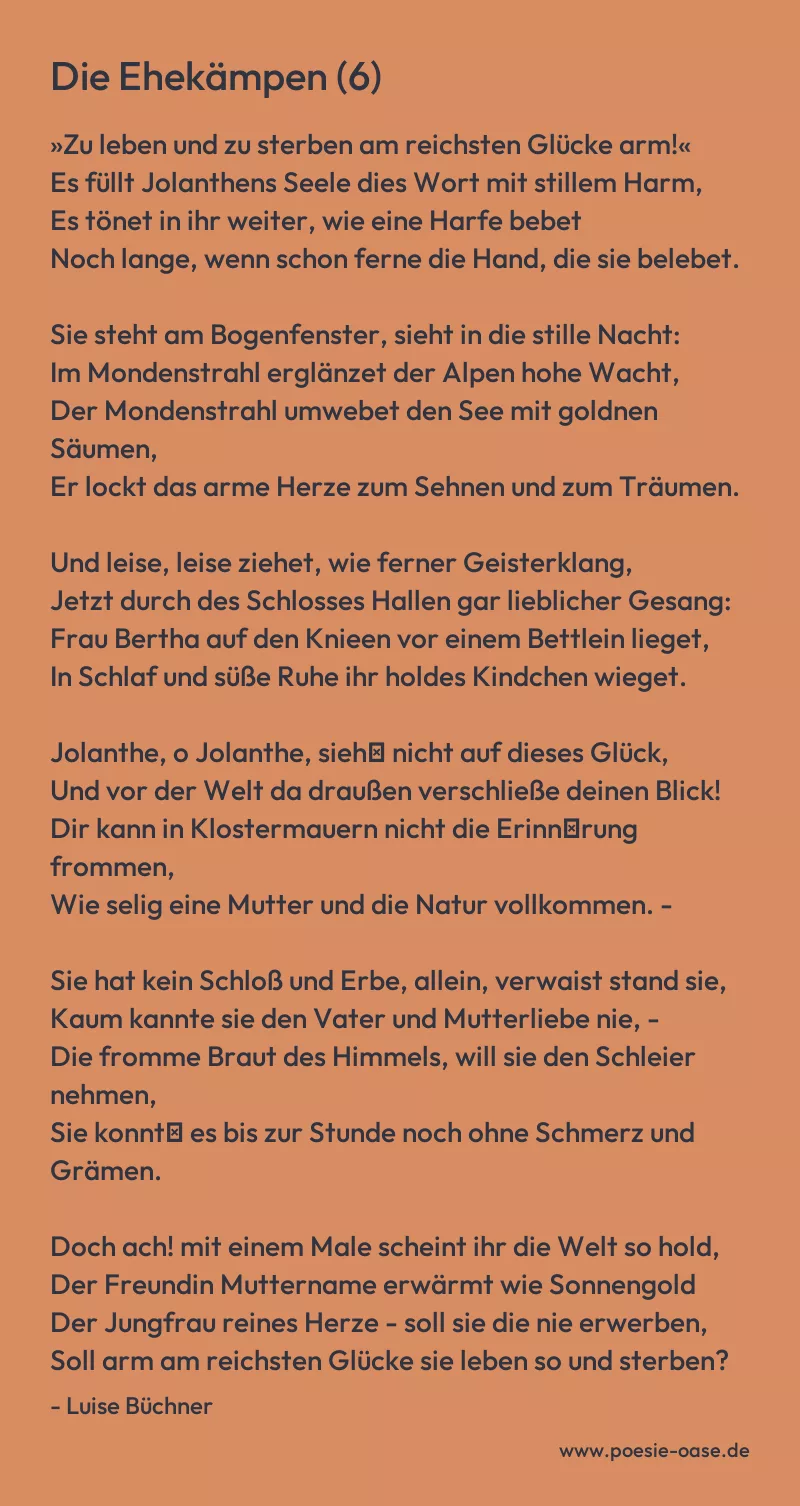»Zu leben und zu sterben am reichsten Glücke arm!«
Es füllt Jolanthens Seele dies Wort mit stillem Harm,
Es tönet in ihr weiter, wie eine Harfe bebet
Noch lange, wenn schon ferne die Hand, die sie belebet.
Sie steht am Bogenfenster, sieht in die stille Nacht:
Im Mondenstrahl erglänzet der Alpen hohe Wacht,
Der Mondenstrahl umwebet den See mit goldnen Säumen,
Er lockt das arme Herze zum Sehnen und zum Träumen.
Und leise, leise ziehet, wie ferner Geisterklang,
Jetzt durch des Schlosses Hallen gar lieblicher Gesang:
Frau Bertha auf den Knieen vor einem Bettlein lieget,
In Schlaf und süße Ruhe ihr holdes Kindchen wieget.
Jolanthe, o Jolanthe, sieh′ nicht auf dieses Glück,
Und vor der Welt da draußen verschließe deinen Blick!
Dir kann in Klostermauern nicht die Erinn′rung frommen,
Wie selig eine Mutter und die Natur vollkommen. –
Sie hat kein Schloß und Erbe, allein, verwaist stand sie,
Kaum kannte sie den Vater und Mutterliebe nie, –
Die fromme Braut des Himmels, will sie den Schleier nehmen,
Sie konnt′ es bis zur Stunde noch ohne Schmerz und Grämen.
Doch ach! mit einem Male scheint ihr die Welt so hold,
Der Freundin Muttername erwärmt wie Sonnengold
Der Jungfrau reines Herze – soll sie die nie erwerben,
Soll arm am reichsten Glücke sie leben so und sterben?