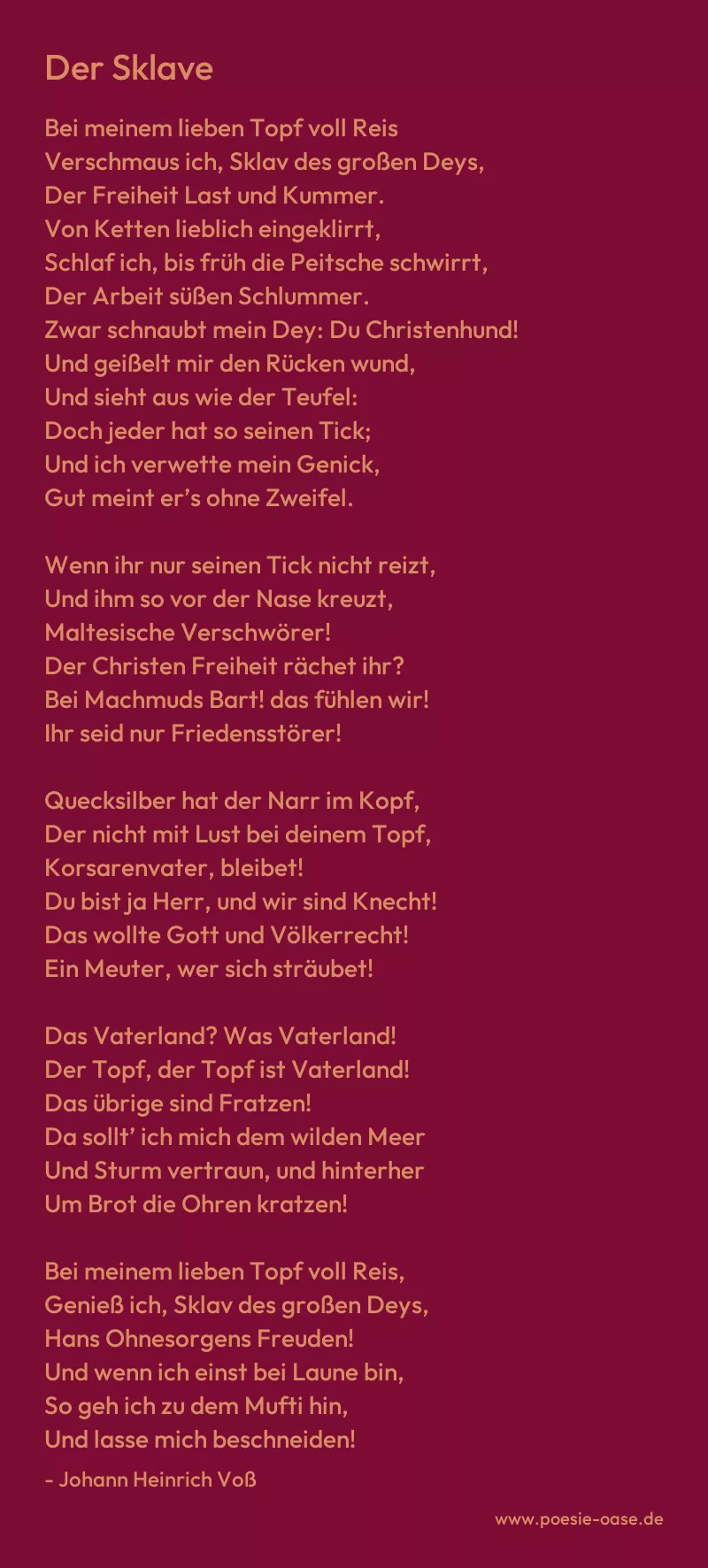Der Sklave
Bei meinem lieben Topf voll Reis
Verschmaus ich, Sklav des großen Deys,
Der Freiheit Last und Kummer.
Von Ketten lieblich eingeklirrt,
Schlaf ich, bis früh die Peitsche schwirrt,
Der Arbeit süßen Schlummer.
Zwar schnaubt mein Dey: Du Christenhund!
Und geißelt mir den Rücken wund,
Und sieht aus wie der Teufel:
Doch jeder hat so seinen Tick;
Und ich verwette mein Genick,
Gut meint er’s ohne Zweifel.
Wenn ihr nur seinen Tick nicht reizt,
Und ihm so vor der Nase kreuzt,
Maltesische Verschwörer!
Der Christen Freiheit rächet ihr?
Bei Machmuds Bart! das fühlen wir!
Ihr seid nur Friedensstörer!
Quecksilber hat der Narr im Kopf,
Der nicht mit Lust bei deinem Topf,
Korsarenvater, bleibet!
Du bist ja Herr, und wir sind Knecht!
Das wollte Gott und Völkerrecht!
Ein Meuter, wer sich sträubet!
Das Vaterland? Was Vaterland!
Der Topf, der Topf ist Vaterland!
Das übrige sind Fratzen!
Da sollt’ ich mich dem wilden Meer
Und Sturm vertraun, und hinterher
Um Brot die Ohren kratzen!
Bei meinem lieben Topf voll Reis,
Genieß ich, Sklav des großen Deys,
Hans Ohnesorgens Freuden!
Und wenn ich einst bei Laune bin,
So geh ich zu dem Mufti hin,
Und lasse mich beschneiden!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
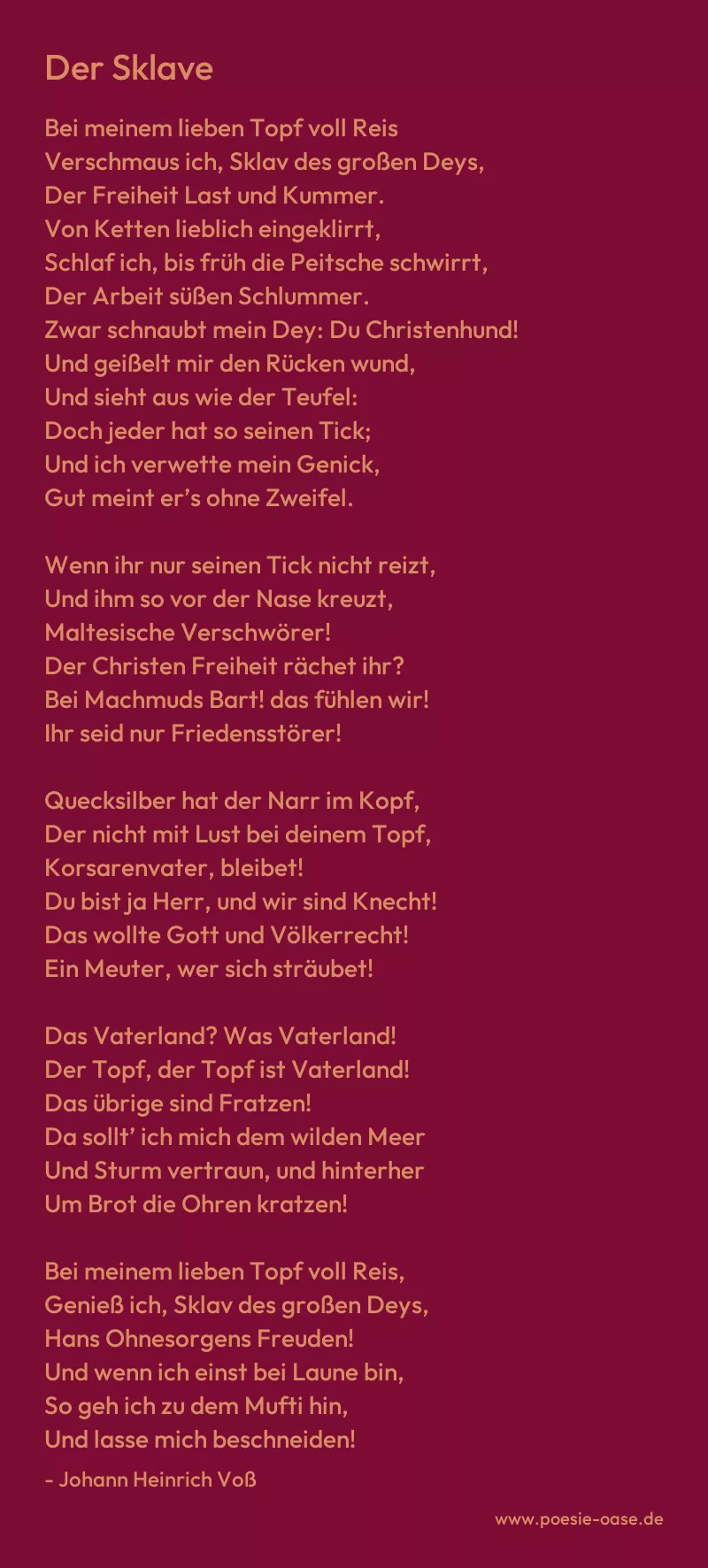
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sklave“ von Johann Heinrich Voß ist eine satirische Auseinandersetzung mit dem Thema Freiheit und Knechtschaft, die in einem unerwarteten Licht dargestellt wird. Der Sprecher, ein Sklave des „großen Deys“, preist die vermeintlichen Vorteile seines Daseins als Sklave, wobei er die Last der Freiheit, wie sie von den „malthesischen Verschwörern“ angestrebt wird, verhöhnt. Seine Haltung ist von Ironie geprägt, da er die physischen und emotionalen Misshandlungen, denen er ausgesetzt ist, verharmlost und sogar als angenehm empfindet.
Die Ironie wird durch die scheinbar naive und undankbare Haltung des Sklaven verstärkt. Er beschreibt die Peitschenhiebe als Teil des „süßen Schlummers“ und rechtfertigt die Brutalität des Deys mit der Phrase „Gut meint er’s ohne Zweifel“. Diese verdrehte Logik verdeutlicht die Perversion der Werte, die durch die Sklaverei verursacht wird. Das „Vaterland“ wird auf den „Topf voll Reis“ reduziert, was die materielle Fixierung und die fehlende Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung des Sklaven unterstreicht. Die scheinbare Zufriedenheit und der Mangel an Ambition zeigen die Verformung des Charakters, die durch die Unterdrückung hervorgerufen wird.
Die politischen Untertöne des Gedichts sind deutlich. Der Sprecher kritisiert die „malthesischen Verschwörer“ als „Friedensstörer“, die offenbar versuchen, die bestehende Ordnung aufzubrechen. Dies kann als eine Anspielung auf revolutionäre Bewegungen oder Bestrebungen nach sozialer Gerechtigkeit interpretiert werden, die von dem Sklaven als destabilisierend und unerwünscht angesehen werden. Die Verwendung von religiösen Bezügen, wie die Erwähnung von „Machmuds Bart“ und die Absicht, sich vom Mufti beschneiden zu lassen, deutet auf die Absurdität hin, die der Sprecher akzeptiert, um seinen Lebensstandard zu erhalten.
Die sprachliche Gestaltung trägt ebenfalls zur Ironie bei. Der einfache, umgangssprachliche Ton, der Reichtum an Reimen und die scheinbare Unbedarftheit des Sprechers verstärken den satirischen Effekt. Der Wechsel von scheinbar idyllischen Beschreibungen des „Topfs voll Reis“ zu der brutalen Realität der Sklaverei schafft einen Kontrast, der die Widersprüchlichkeit der Situation hervorhebt. Die Wiederholung des Refrains „Bei meinem lieben Topf voll Reis“ verankert die materielle Grundlage der Zufriedenheit des Sklaven und unterstreicht die Leere seiner geistigen und emotionalen Welt.
Insgesamt ist „Der Sklave“ eine scharfsinnige Satire auf die menschliche Fähigkeit zur Anpassung und Selbsttäuschung. Es hinterfragt die Werte von Freiheit und Würde und wirft die Frage auf, wie leicht Menschen dazu bereit sind, ihre grundlegendsten Rechte für vermeintliche Sicherheit oder Bequemlichkeit zu opfern. Die Ironie des Gedichts, die durch die scheinbare Zufriedenheit des Sklaven und die Verhöhnung der Freiheit entsteht, macht es zu einem eindringlichen Kommentar zur menschlichen Natur und den Gefahren der Unterdrückung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.