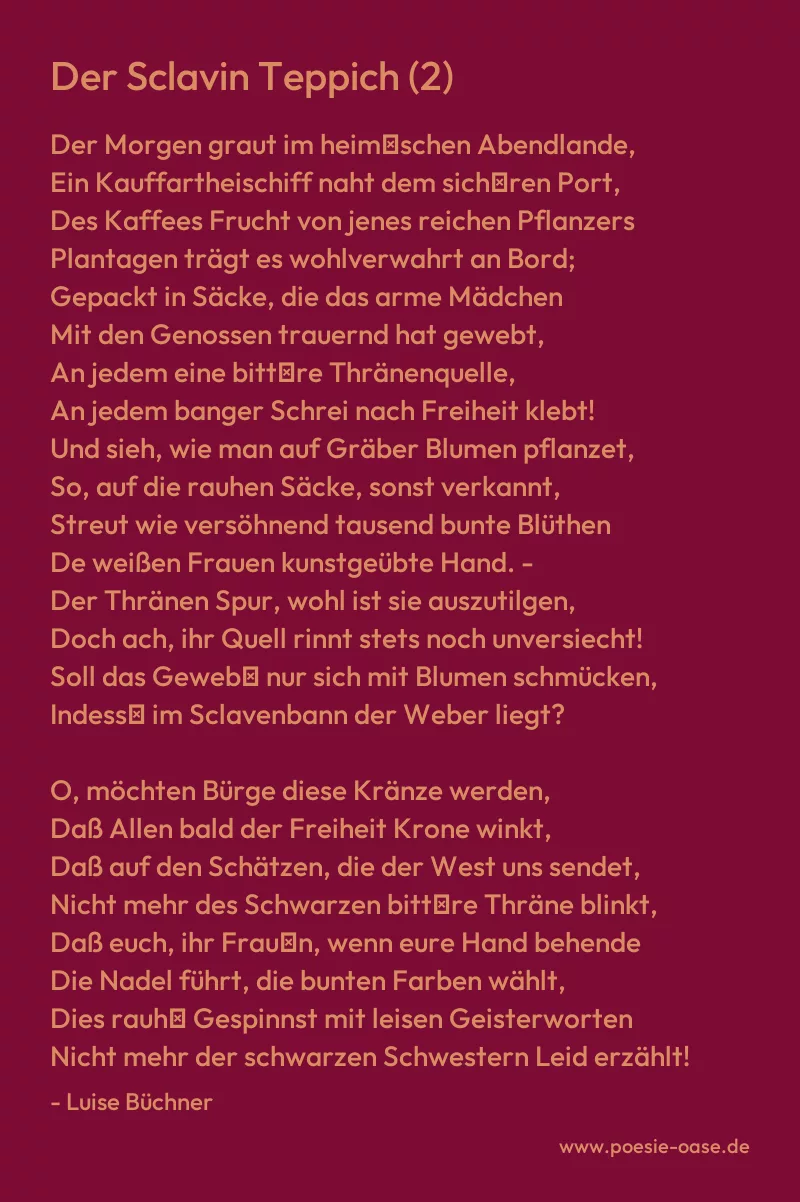Der Sclavin Teppich (2)
Der Morgen graut im heim′schen Abendlande,
Ein Kauffartheischiff naht dem sich′ren Port,
Des Kaffees Frucht von jenes reichen Pflanzers
Plantagen trägt es wohlverwahrt an Bord;
Gepackt in Säcke, die das arme Mädchen
Mit den Genossen trauernd hat gewebt,
An jedem eine bitt′re Thränenquelle,
An jedem banger Schrei nach Freiheit klebt!
Und sieh, wie man auf Gräber Blumen pflanzet,
So, auf die rauhen Säcke, sonst verkannt,
Streut wie versöhnend tausend bunte Blüthen
De weißen Frauen kunstgeübte Hand. –
Der Thränen Spur, wohl ist sie auszutilgen,
Doch ach, ihr Quell rinnt stets noch unversiecht!
Soll das Geweb′ nur sich mit Blumen schmücken,
Indess′ im Sclavenbann der Weber liegt?
O, möchten Bürge diese Kränze werden,
Daß Allen bald der Freiheit Krone winkt,
Daß auf den Schätzen, die der West uns sendet,
Nicht mehr des Schwarzen bitt′re Thräne blinkt,
Daß euch, ihr Frau′n, wenn eure Hand behende
Die Nadel führt, die bunten Farben wählt,
Dies rauh′ Gespinnst mit leisen Geisterworten
Nicht mehr der schwarzen Schwestern Leid erzählt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
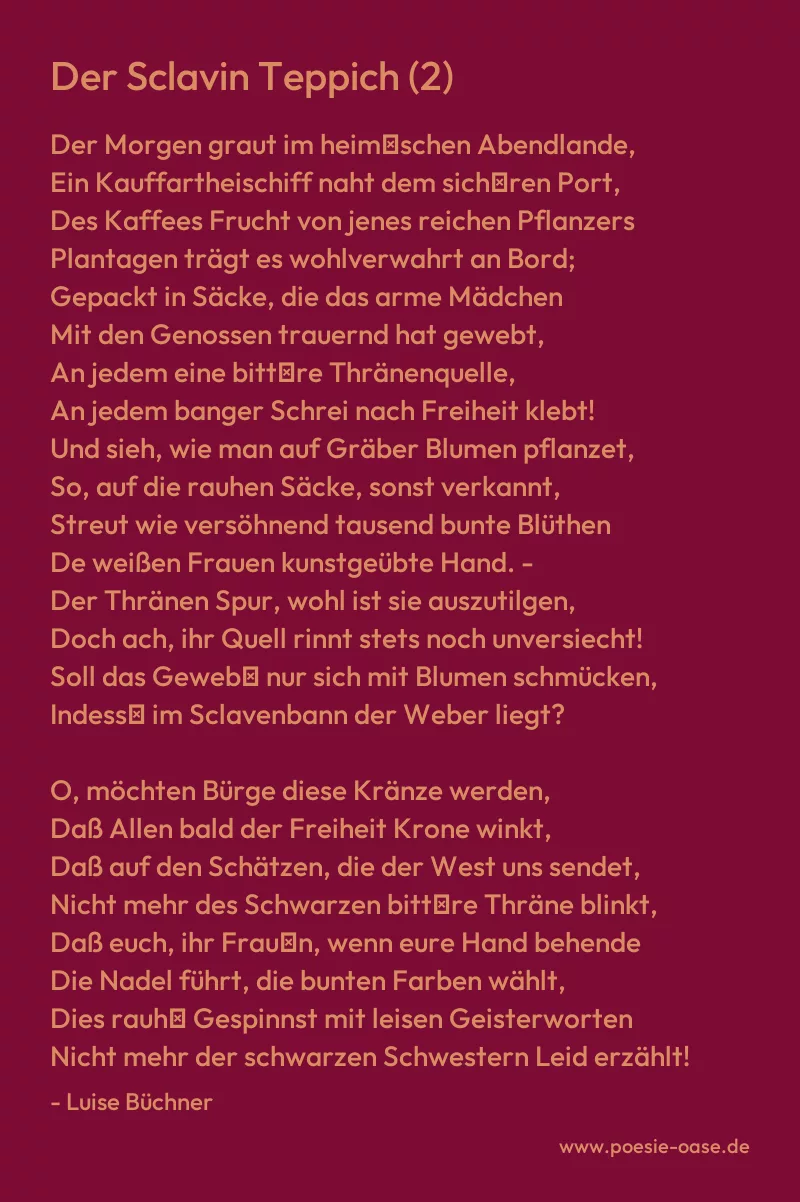
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sclavin Teppich (2)“ von Luise Büchner ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit der Sklaverei und ihrer indirekten Beteiligung durch den Handel. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung eines Morgens, der im „heim′schen Abendlande“ anbricht, und der Ankunft eines Handelsschiffs, das Kaffeebohnen von einer Plantage transportiert. Büchner stellt die paradoxe Situation dar, in der Konsumgüter wie Kaffee, die als Genussmittel dienen, durch die Ausbeutung und das Leid von Sklaven produziert werden.
Der Hauptteil des Gedichts konzentriert sich auf die Perspektive der versklavten Frauen, die die Säcke für den Kaffee weben. Büchner beschreibt deren Leid und Trauer, die in jedem Sack, in jedem Faden des Gewebes widergespiegelt werden. Die Metapher der „bitt′re Thränenquelle“ und der „banger Schrei nach Freiheit“ verdeutlicht die Hoffnungslosigkeit und den Schmerz der Sklavinnen. Der Kontrast zwischen der Arbeit der Sklavinnen und dem Genuss der Konsumenten, dargestellt durch die Blumen, die die weißen Frauen auf die Säcke streuen, unterstreicht die Ungerechtigkeit der Situation.
Im zweiten Teil des Gedichts wendet sich Büchner an die weißen Frauen und fordert sie auf, sich der Problematik bewusst zu werden. Sie drückt den Wunsch aus, dass die Blumen, die die Frauen weben, zu „Kränzen“ der Freiheit werden und dass die Tränen der schwarzen Schwestern in Zukunft nicht mehr auf den Handelsgütern widergespiegelt werden. Die Verwendung von Ausdrücken wie „Geisterworten“ deutet auf die Mahnung, die die Frauen durch ihr Handwerk an die Ungerechtigkeit erinnern soll.
Das Gedicht ist ein Appell an das Gewissen der Leserinnen und Leser, die Verantwortung für die Ausbeutung von Sklaven zu übernehmen. Durch die Gegenüberstellung von Genuss und Leid, von Reichtum und Armut, von Schönheit und Schmerz zeigt Büchner auf, wie eng der Handel mit der Sklaverei verbunden ist. Die Sprache ist ergreifend und bildhaft, die Bilder von Tränen, Blumen und Geweben erzeugen eine starke emotionale Wirkung und machen die Leserinnen und Leser zu Mitwissenden in diesem Kampf gegen die Sklaverei.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.