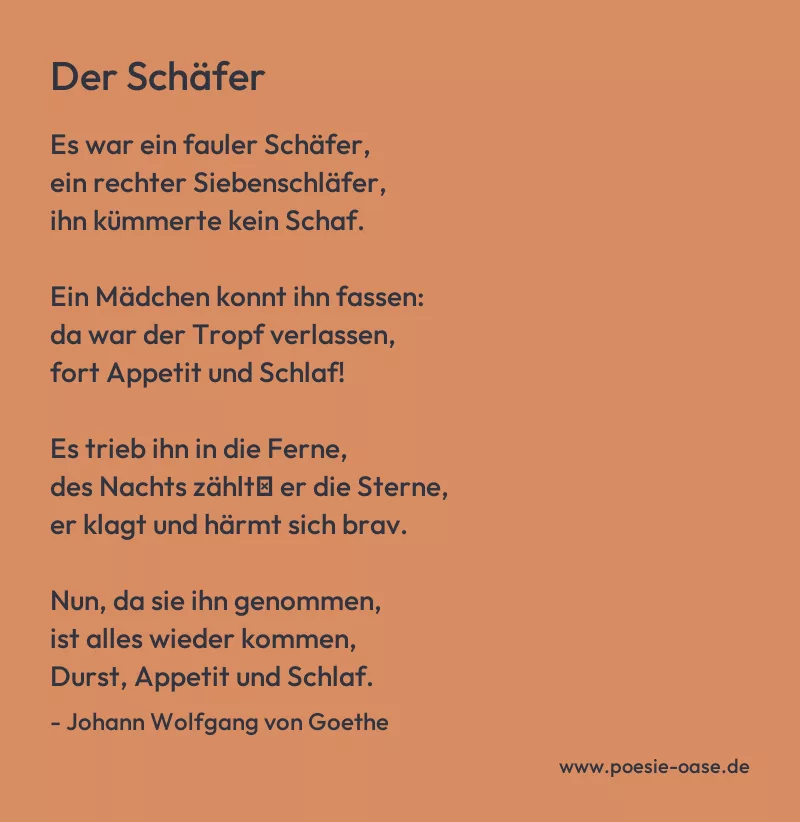Der Schäfer
Es war ein fauler Schäfer,
ein rechter Siebenschläfer,
ihn kümmerte kein Schaf.
Ein Mädchen konnt ihn fassen:
da war der Tropf verlassen,
fort Appetit und Schlaf!
Es trieb ihn in die Ferne,
des Nachts zählt′ er die Sterne,
er klagt und härmt sich brav.
Nun, da sie ihn genommen,
ist alles wieder kommen,
Durst, Appetit und Schlaf.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
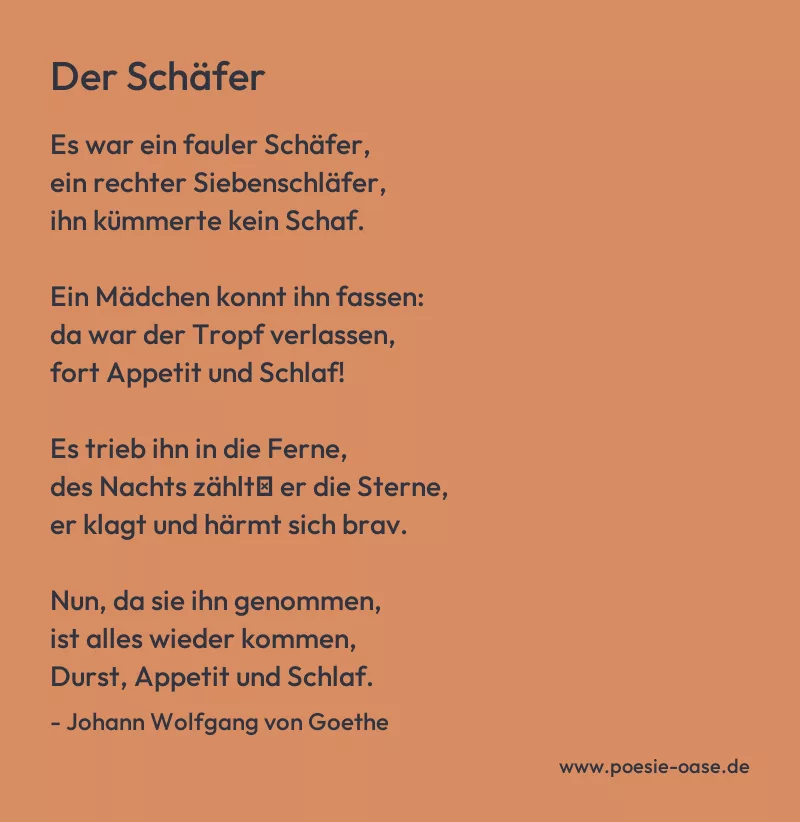
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Schäfer“ von Johann Wolfgang von Goethe zeichnet sich durch seine pointierte Kürze und die satirische Darstellung eines unkonventionellen Schäfers aus. Es beginnt mit der Beschreibung eines Mannes, der scheinbar keinerlei Pflichtgefühl verspürt und dem seine Schafe völlig gleichgültig sind. Diese Einleitung etabliert sofort einen ironischen Ton, da der Schäferberuf traditionell mit Verantwortung und Fürsorge verbunden ist.
Die zweite Strophe bringt die Wendung: Ein Mädchen erweckt das Interesse des Schäfers, und plötzlich verändert sich sein Verhalten grundlegend. Er verliert seinen Appetit und Schlaf, was die Intensität seiner neuen Liebe oder Verliebtheit unterstreicht. Diese Veränderung wird als eine Art Lähmung dargestellt, die den Schäfer unfähig macht, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Der Kontrast zwischen dem faulen, schläfrigen Schäfer und dem verliebten Mann ist deutlich und humorvoll.
Die letzte Strophe führt die überraschende Pointe ein. Nachdem das Mädchen ihn „genommen“ hat, kehren seine ursprünglichen Bedürfnisse und Eigenschaften zurück: Durst, Appetit und Schlaf. Dies ist eine klare Umkehrung der Erwartungen und enthüllt eine ironische Erkenntnis über die Natur der Liebe und des Begehrens. Offenbar war die anfängliche Verliebtheit nur eine vorübergehende Erscheinung, die durch die Erfüllung des Begehrens ihren Reiz verloren hat. Der Schäfer kehrt zu seinem ursprünglichen Zustand zurück, was die Oberflächlichkeit seiner Gefühle andeutet.
Goethes Gedicht ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur. Es spielt mit Erwartungen und offenbart die Ambivalenz von Gefühlen wie Liebe und Verlangen. Die einfache Sprache und der klare Rhythmus machen das Gedicht leicht verständlich und zugänglich, während die unerwartete Wendung und die satirische Darstellung des Schäfers den Leser zum Nachdenken anregen und zum Schmunzeln bringen. Die Moral der Geschichte könnte sein, dass wahre Liebe, oder zumindest nachhaltige Liebe, mehr beinhaltet als bloßes Begehren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.