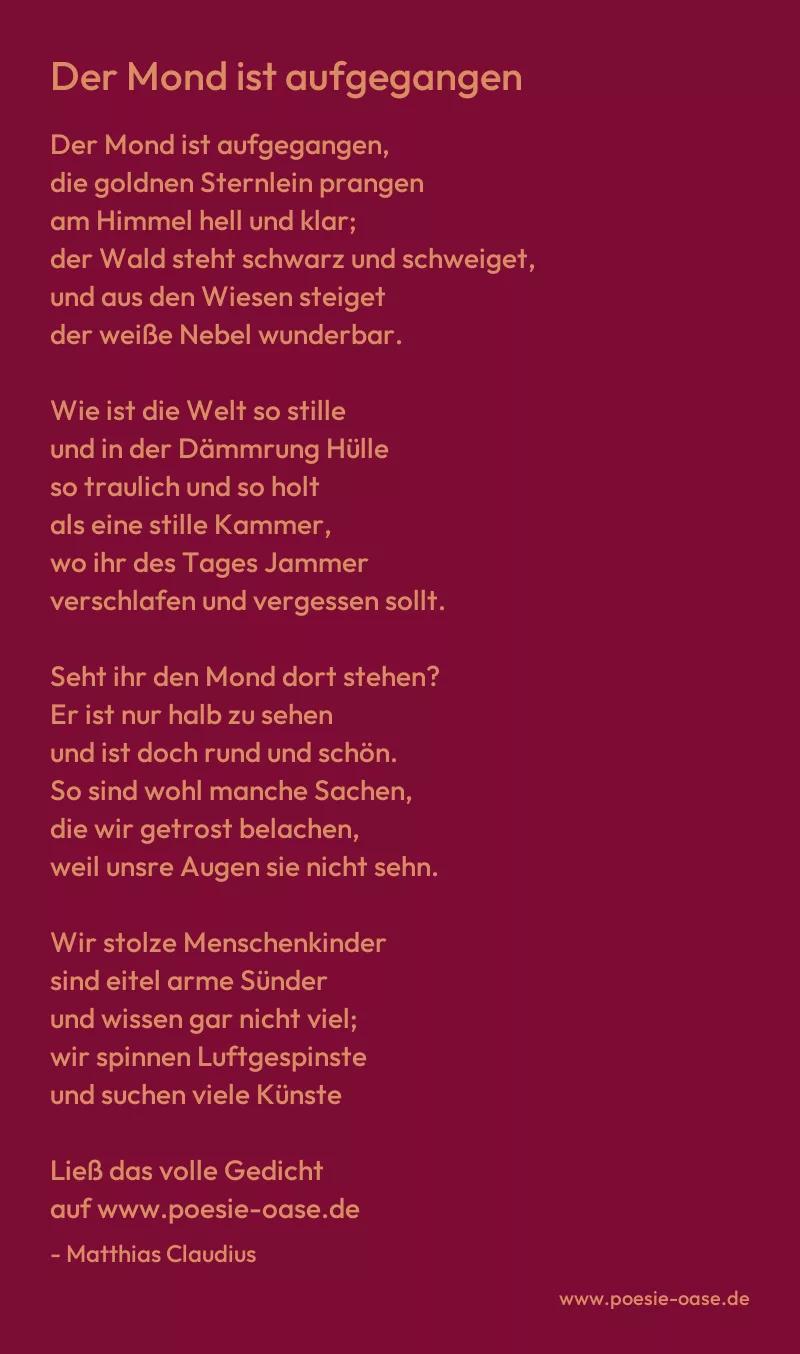Fortschritt, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Gegenwart, Götter, Herbst, Himmel & Wolken, Jahreszeiten, Märchen & Fantasie, Religion, Wissenschaft & Technik
Der Mond ist aufgegangen
Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar;
der Wald steht schwarz und schweiget,
und aus den Wiesen steiget
der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traulich und so holt
als eine stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolze Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel;
wir spinnen Luftgespinste
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß dein Heil uns schauen,
auf nichts Vergänglichs bauen,
nicht Eitelkeit uns freun;
laß uns einfältig werden
und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein.
Wollst endlich sonder Grämen
aus dieser Welt uns nehmen
durch einen sanften Tod;
und wenn du uns genommen,
laß uns in Himmel kommen,
du unser Herr und unser Gott.
So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und laß uns ruhig schlafen
und unsern kranken Nachbar auch.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
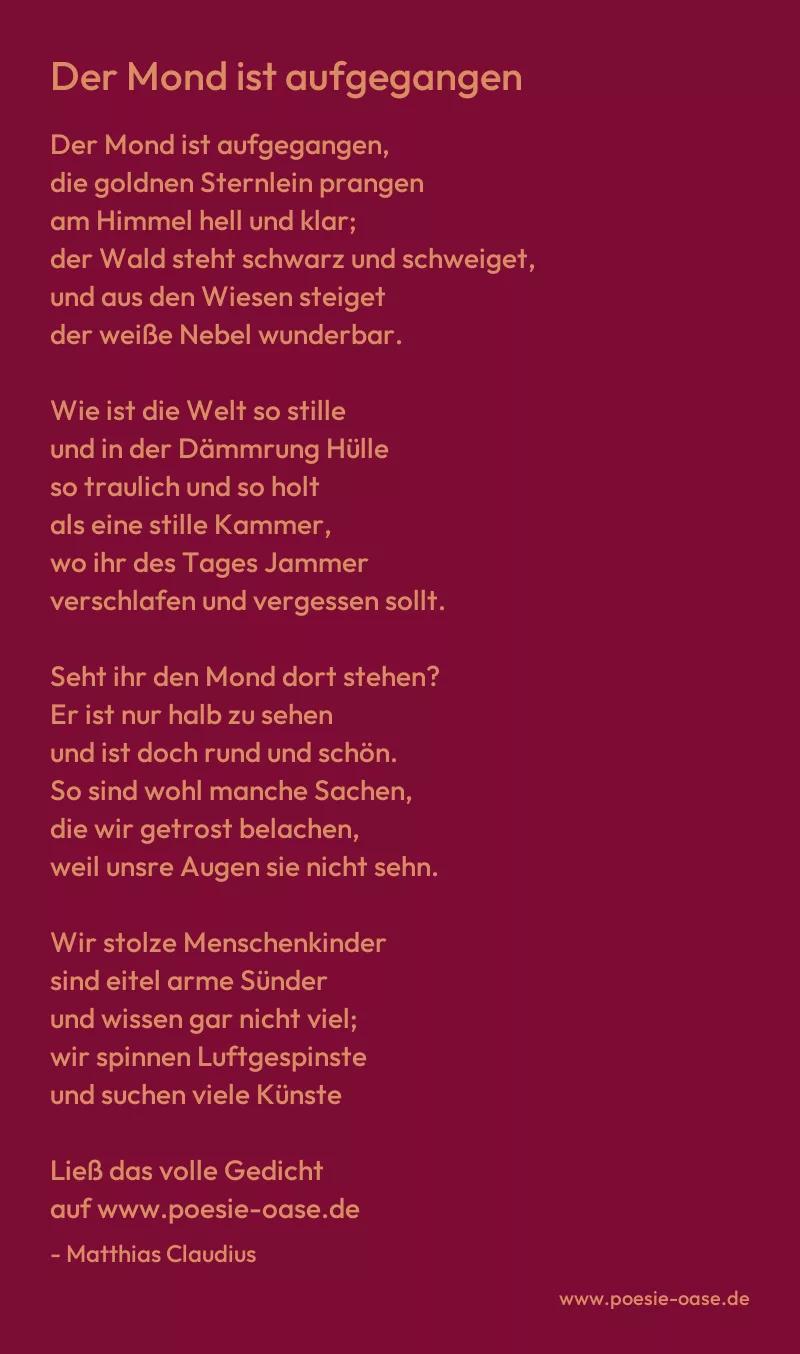
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius ist eine Abend- und Nachtstimmung einfangende Betrachtung, die über die bloße Naturbeschreibung hinausgeht und tiefe religiöse und philosophische Gedanken anregt. Es beginnt mit der idyllischen Schilderung einer friedlichen Nachtszene, in der der Mond und die Sterne am Himmel leuchten und der Nebel aus den Wiesen aufsteigt. Diese anfängliche Beschreibung schafft eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens, die den Leser in ihren Bann zieht und auf die nachfolgenden, besinnlichen Strophen vorbereitet.
Die zweite Strophe vertieft die meditative Stimmung, indem sie die Welt als „so stille“ beschreibt, „so traulich und so hold“. Diese Zeilen laden dazu ein, die Alltagssorgen zu vergessen und sich in die Geborgenheit der Nacht zurückzuziehen, die wie eine „stille Kammer“ wirkt. Die folgenden Verse offenbaren eine tiefergehende Botschaft, die auf die menschliche Beschränktheit und die Grenzen des menschlichen Wissens hinweist. Die Metapher des Mondes, der nur halb sichtbar ist, aber dennoch rund und schön, mahnt den Leser, die Welt mit Demut und Ehrfurcht zu betrachten.
Die dritte und vierte Strophe stellen einen Kontrast zur besinnlichen Naturdarstellung dar, indem sie die menschliche Eitelkeit und das Streben nach Wissen thematisieren. Claudius kritisiert die „stolzen Menschenkinder“, die sich in ihrem Wissen verlieren und sich von ihren eigentlichen Zielen entfernen. Die Metaphern „Luftgespinste“ und „viele Künste“ verdeutlichen die Sinnlosigkeit des rein irdischen Strebens. Diese Zeilen dienen als Appell, sich nicht von weltlichen Dingen ablenken zu lassen, sondern sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die ewigen Werte.
In den letzten Strophen erreicht das Gedicht seinen Höhepunkt, indem es eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Gnade und Erlösung zum Ausdruck bringt. Der Dichter bittet um Demut, Glauben und die Fähigkeit, wie Kinder zu sein, die sich der Liebe und dem Schutz Gottes anvertrauen. Die Bitte um einen „sanften Tod“ und die Hoffnung auf das ewige Leben im Himmel spiegeln eine tiefe Vertrautheit mit dem Glauben wider und lassen das Gedicht mit einer friedlichen Zuversicht ausklingen. Die letzte Strophe, die mit dem Aufruf endet, sich in Gottes Namen niederzulegen und friedlich zu schlafen, verbindet das Gedicht mit dem Alltagsleben und lädt den Leser ein, die gelernten Werte in seinem eigenen Leben umzusetzen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.