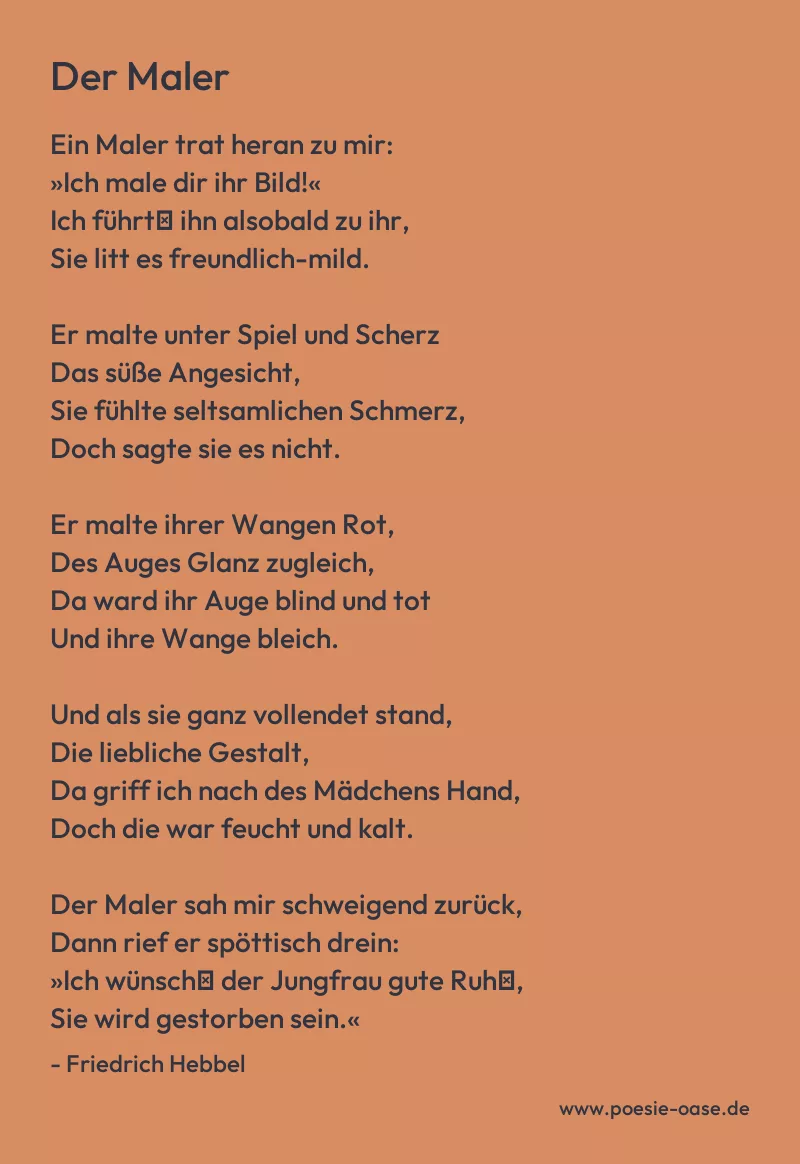Der Maler
Ein Maler trat heran zu mir:
»Ich male dir ihr Bild!«
Ich führt′ ihn alsobald zu ihr,
Sie litt es freundlich-mild.
Er malte unter Spiel und Scherz
Das süße Angesicht,
Sie fühlte seltsamlichen Schmerz,
Doch sagte sie es nicht.
Er malte ihrer Wangen Rot,
Des Auges Glanz zugleich,
Da ward ihr Auge blind und tot
Und ihre Wange bleich.
Und als sie ganz vollendet stand,
Die liebliche Gestalt,
Da griff ich nach des Mädchens Hand,
Doch die war feucht und kalt.
Der Maler sah mir schweigend zurück,
Dann rief er spöttisch drein:
»Ich wünsch′ der Jungfrau gute Ruh′,
Sie wird gestorben sein.«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
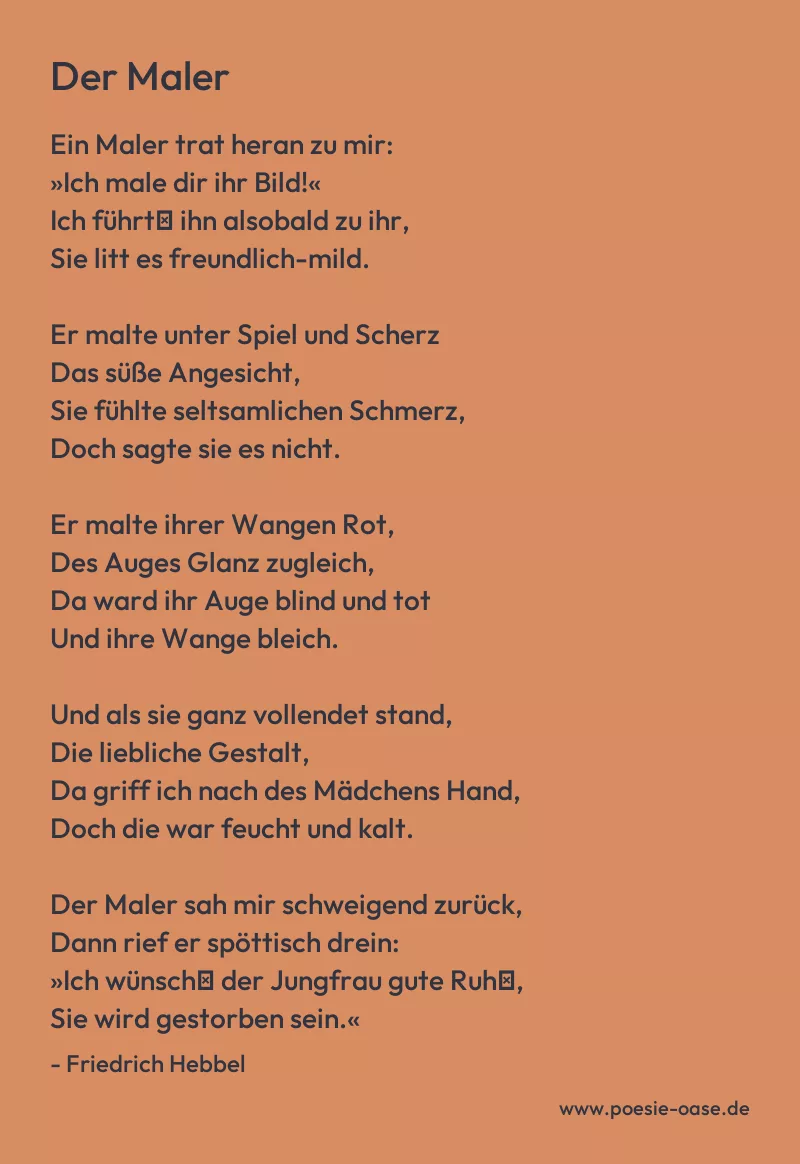
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Maler“ von Friedrich Hebbel zeichnet ein verstörendes Bild von der Beziehung zwischen Kunst, Schönheit und Tod. Es beginnt mit einer scheinbar harmlosen Szene: Ein Maler bietet an, das Bild einer jungen Frau zu malen, und sie willigt freundlich ein. Der Maler arbeitet spielerisch und mit Humor, während die Frau eine seltsame, unerklärliche Empfindung verspürt, ohne diese jedoch zu äußern. Schon in diesen ersten beiden Strophen etabliert Hebbel eine Atmosphäre der Vorahnung und unterschwelligen Bedrohung.
Die zweite Hälfte des Gedichts nimmt eine düstere Wendung. Der Maler konzentriert sich auf die physischen Merkmale der Frau – ihre Wangen, ihre Augen – und während er diese Details festhält, ereignet sich eine Metamorphose. Ihre Augen werden „blind und tot“, ihre Wangen „bleich“. Die Kunst, die eigentlich dazu dienen sollte, Schönheit zu bewahren, scheint diese Schönheit in einen leblosen Zustand zu verwandeln. Der Prozess der Malerei wird hier als eine Art destruktiver Akt dargestellt, der die Lebendigkeit der Frau aussaugt.
Die letzte Strophe offenbart das ganze Ausmaß der Tragödie. Die vollendete Darstellung der Frau ist nun eine bloße „Gestalt“, und ihre Hand ist kalt und feucht. Der Maler, der Zeuge dieses Prozesses war, spricht mit sarkastischer Bemerkung „Sie wird gestorben sein.“ Dieser Kommentar unterstreicht die Ironie des Gedichts: Die Kunst hat die Frau nicht nur abgebildet, sondern buchstäblich getötet. Die Kunst, die zunächst als Medium der Bewahrung erschien, entpuppt sich als Ursache des Todes.
Hebbel thematisiert in diesem Gedicht auf eindringliche Weise die ambivalente Natur der Kunst. Sie kann Schönheit erfassen und verewigen, aber auch die Lebendigkeit und Originalität des Gegenstands zerstören. Das Gedicht wirft Fragen über die Beziehung zwischen dem Künstler, dem Kunstwerk und dem Modell auf, und deutet darauf hin, dass die Schaffung von Kunst, insbesondere in ihrer Beziehung zur Darstellung der menschlichen Existenz, stets eine gewisse Tragik in sich birgt. Das Gedicht ist eine eindringliche Meditation über die Grenzen der Kunst und die Konsequenzen der Obsession mit Schönheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.