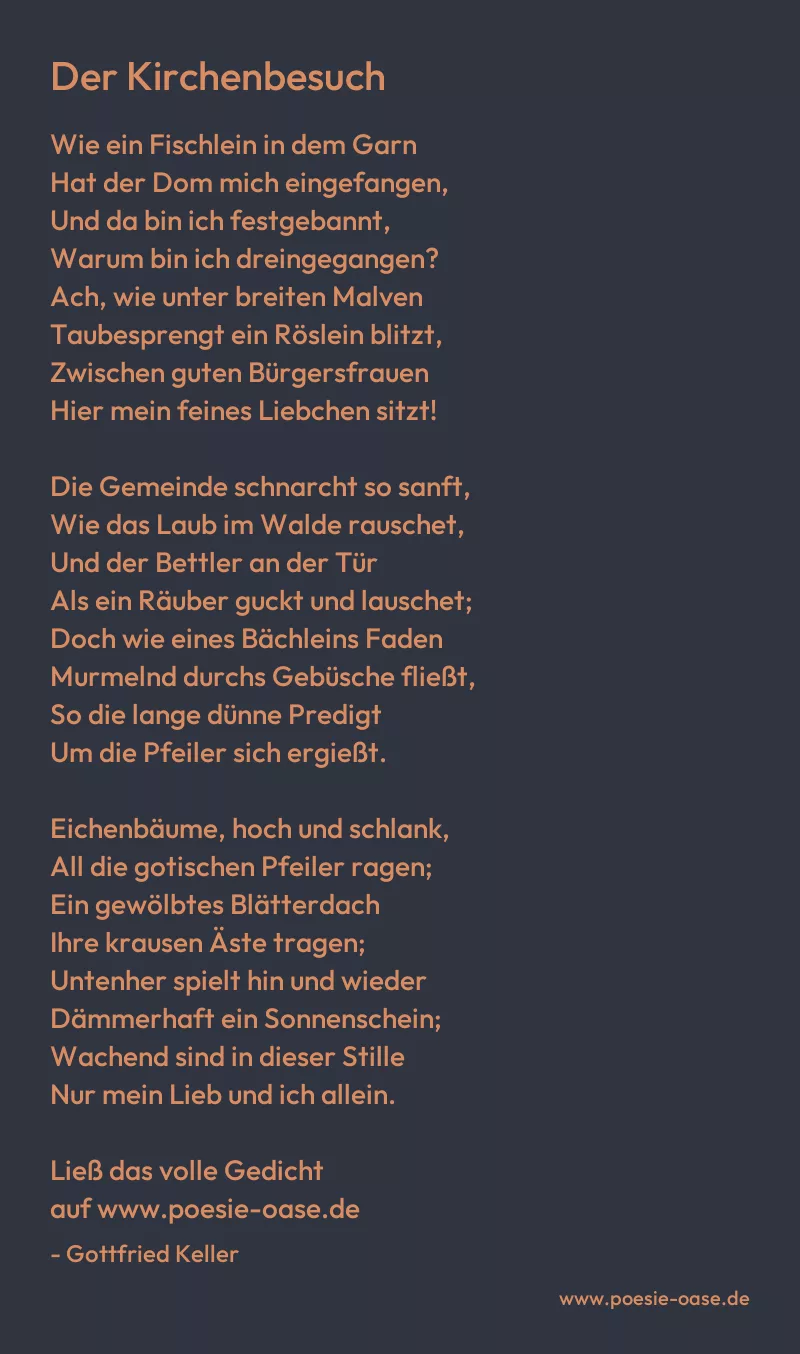Wie ein Fischlein in dem Garn
Hat der Dom mich eingefangen,
Und da bin ich festgebannt,
Warum bin ich dreingegangen?
Ach, wie unter breiten Malven
Taubesprengt ein Röslein blitzt,
Zwischen guten Bürgersfrauen
Hier mein feines Liebchen sitzt!
Die Gemeinde schnarcht so sanft,
Wie das Laub im Walde rauschet,
Und der Bettler an der Tür
Als ein Räuber guckt und lauschet;
Doch wie eines Bächleins Faden
Murmelnd durchs Gebüsche fließt,
So die lange dünne Predigt
Um die Pfeiler sich ergießt.
Eichenbäume, hoch und schlank,
All die gotischen Pfeiler ragen;
Ein gewölbtes Blätterdach
Ihre krausen Äste tragen;
Untenher spielt hin und wieder
Dämmerhaft ein Sonnenschein;
Wachend sind in dieser Stille
Nur mein Lieb und ich allein.
Zwischen uns webt sich ein Netz
Von des Lichts gebrochnem Strahle,
Drin der Taufstein, grün und rot,
Wandelt sich zur Blumenschale;
Ein geflügelt Knäblein flattert
Auf des Deckels altem Knauf,
Und es gehen uns im Busen
Auch der Sehnsucht Rosen auf.
Weit hinaus, ins Morgenland,
Komm, mein Kind, und laß uns fliegen,
Wo die Palmen schwanken am Meer
Und die sel′gen Inseln liegen,
Flutend um die große Sonne,
Grundlos tief die Himmel blaun:
Angesichts der freien Wogen
Unsre Seelen frei zu traun!