Der größte Mensch bleibt stets ein Menschen-Kind,
die größten Köpfe sind das nur, was andre sind;
allein, das merkt, sie sind es umgekehrt;
sie wollen nicht mit andern Erdentröpfen
auf ihren Füßen geht, sie gehen auf ihren Köpfen,
verachten, was ein jeder ehrt;
und was gemeinen Sinn empört,
das ehren unbefangne Weisen.
Doch brachten sie′s nicht allzu weit,
ihr non plus ultra jeder Zeit
war: Gott zu lästern und den Dreck zu preisen
Der größte Mensch…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
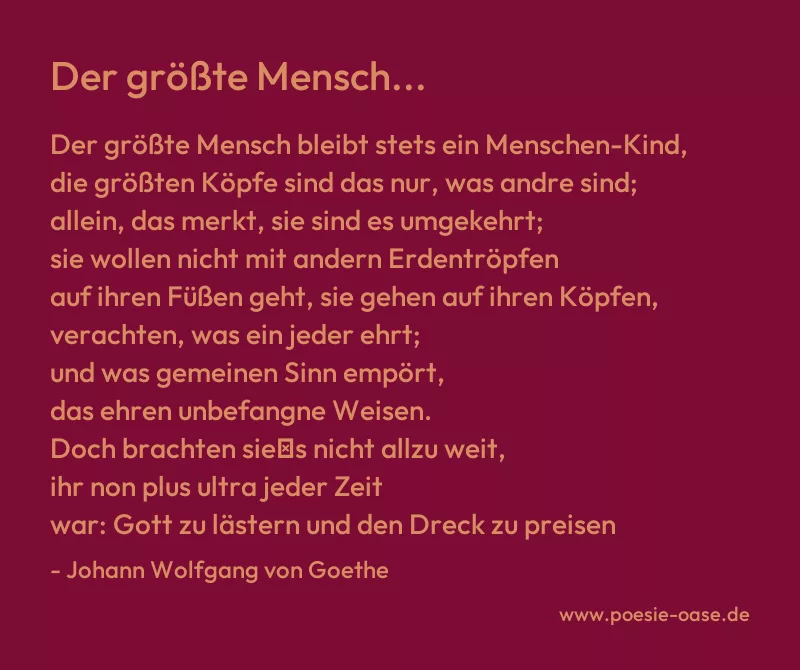
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der größte Mensch“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine bissige Satire, die sich mit dem Phänomen der Intellektuellen und ihrer Abgehobenheit von der Gesellschaft auseinandersetzt. Es beginnt mit der Feststellung, dass selbst die größten Menschen im Grunde genommen „Menschen-Kind[er]“ sind, also im Wesentlichen ebenso menschlich wie alle anderen. Diejenigen, die sich durch ihre „Köpfe“ auszeichnen, werden als solche charakterisiert, die das Wesen der anderen in sich tragen, also in gewissem Sinne Kopien oder Spiegelbilder sind. Doch die wahre Kritik beginnt im darauffolgenden Vers.
Der Kern der Kritik liegt in der Umkehrung: Die vermeintlich großen Geister „wollen nicht mit andern Erdentröpfen / auf ihren Füßen geht, sie gehen auf ihren Köpfen“. Das bedeutet, dass sie sich über die gewöhnlichen Menschen erheben und sich selbst auf eine höhere Ebene stellen. Sie verachten die Werte und Traditionen, die von der Mehrheit der Gesellschaft respektiert werden. Diese Selbstüberschätzung und die Ablehnung des Konventionellen sind die zentralen Merkmale, die Goethe an den Intellektuellen kritisiert.
Die Ironie wird durch die Feststellung verstärkt, dass diese „Weisen“ gerade das ehren, was den „gemeinen Sinn empört“. Das Gedicht deutet an, dass diese Intellektuellen oft dazu neigen, das zu verherrlichen, was die Gesellschaft ablehnt, sei es durch das Hinterfragen von religiösen Dogmen („Gott zu lästern“) oder durch die Wertschätzung des scheinbar Unbedeutenden („den Dreck zu preisen“). Diese Umkehrung von Werten dient dazu, die vermeintliche Überlegenheit der Intellektuellen zu untergraben und ihre Weltfremdheit bloßzustellen.
Die Pointe des Gedichts liegt im scheinbar paradoxen „non plus ultra“ (Höchstes) der Intellektuellen. Ihre Bemühungen kulminieren in Gotteslästerung und der Verherrlichung des Profanen. Damit wird das Scheitern dieser Überheblichkeit deutlich. Das Gedicht kritisiert die Hybris und die Weltfremdheit der Intellektuellen, die sich durch ihre Abneigung gegen die gängigen Normen und ihre vermeintliche Überlegenheit in eine Sackgasse manövrieren. Goethes satirische Meisterschaft liegt in der scharfen Beobachtung und der prägnanten Formulierung dieser Kritik.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
