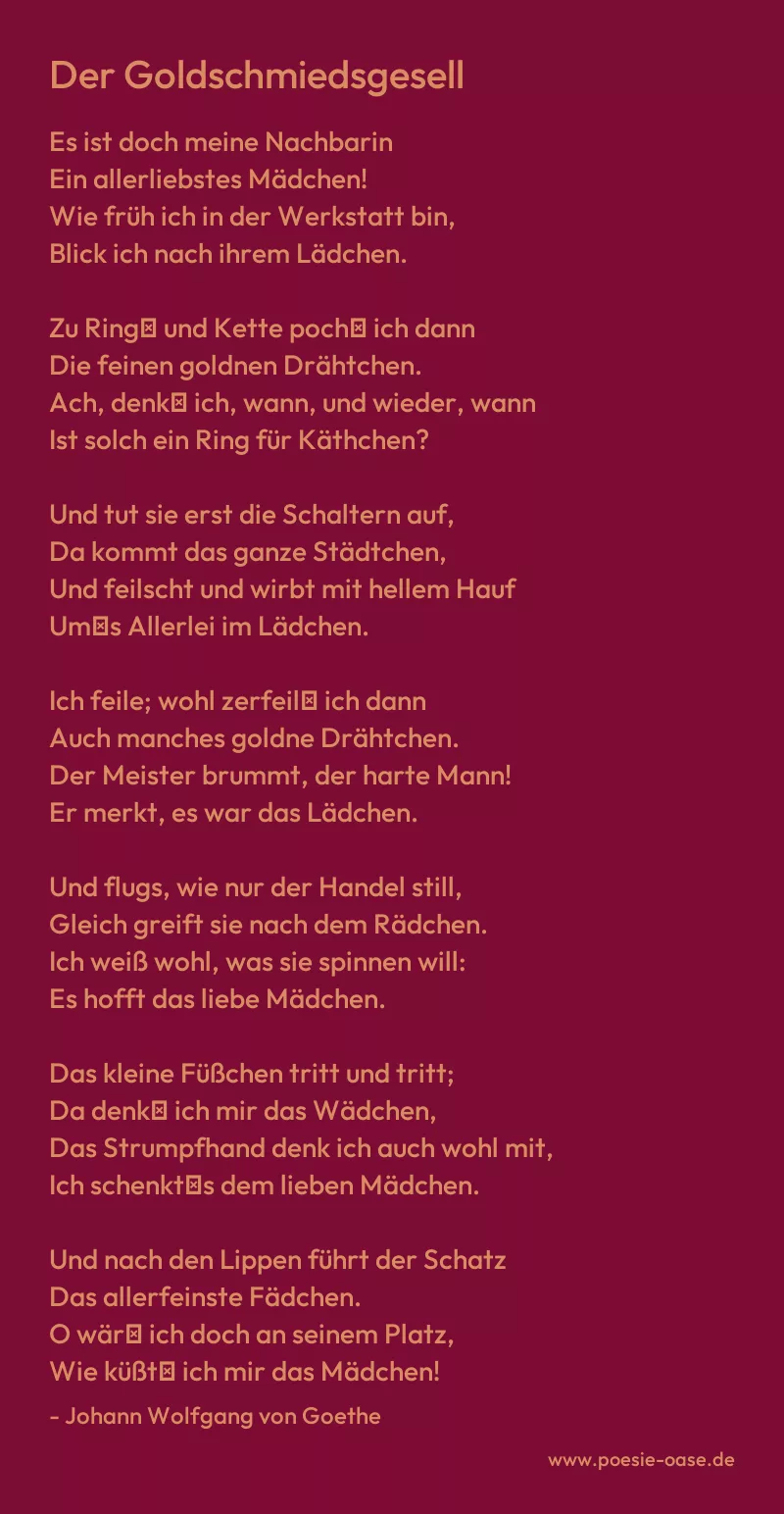Der Goldschmiedsgesell
Es ist doch meine Nachbarin
Ein allerliebstes Mädchen!
Wie früh ich in der Werkstatt bin,
Blick ich nach ihrem Lädchen.
Zu Ring′ und Kette poch′ ich dann
Die feinen goldnen Drähtchen.
Ach, denk′ ich, wann, und wieder, wann
Ist solch ein Ring für Käthchen?
Und tut sie erst die Schaltern auf,
Da kommt das ganze Städtchen,
Und feilscht und wirbt mit hellem Hauf
Um′s Allerlei im Lädchen.
Ich feile; wohl zerfeil′ ich dann
Auch manches goldne Drähtchen.
Der Meister brummt, der harte Mann!
Er merkt, es war das Lädchen.
Und flugs, wie nur der Handel still,
Gleich greift sie nach dem Rädchen.
Ich weiß wohl, was sie spinnen will:
Es hofft das liebe Mädchen.
Das kleine Füßchen tritt und tritt;
Da denk′ ich mir das Wädchen,
Das Strumpfhand denk ich auch wohl mit,
Ich schenkt′s dem lieben Mädchen.
Und nach den Lippen führt der Schatz
Das allerfeinste Fädchen.
O wär′ ich doch an seinem Platz,
Wie küßt′ ich mir das Mädchen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
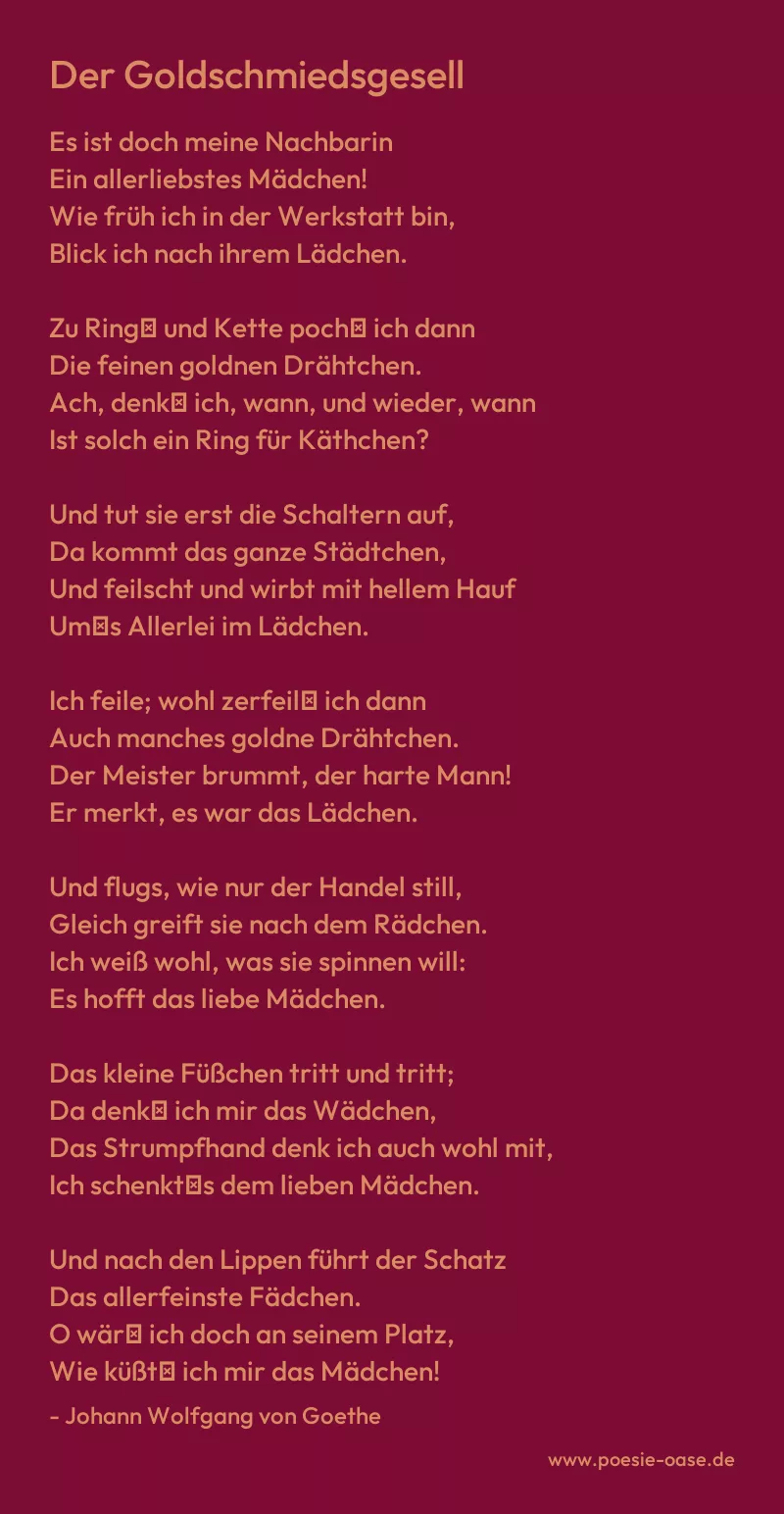
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Goldschmiedsgesell“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine charmante, humorvolle Beobachtung der jugendlichen Liebe und des Begehrens, eingebettet in den Alltag eines Handwerkers. Es schildert die Verliebtheit eines Goldschmiedsgesellen in seine Nachbarin, ein junges Mädchen, und die Ablenkung, die diese Liebe in seinem Arbeitsleben hervorruft.
Goethe verwendet eine einfache, volkstümliche Sprache, die den unkomplizierten Charakter der Liebe des Gesellen widerspiegelt. Die wiederkehrenden Reime und der lockere Rhythmus erzeugen eine gewisse Leichtigkeit, die das Gefühl der Verliebtheit unterstreicht. Der Geselle ist nicht nur von der Schönheit des Mädchens fasziniert, sondern auch von ihrer Tätigkeit im Laden, was seine Beobachtungsgabe und die Allgegenwärtigkeit seiner Gedanken an sie verdeutlicht. Die Werkstatt und das Lädchen, in denen sich ihre Wege kreuzen, bilden den Schauplatz für seine romantischen Tagträume.
Die zentrale Metapher des Gedichts ist die Ablenkung von der Arbeit durch die Liebe. Der Geselle fertigt Ringe und Ketten an, wobei er sich sehnlichst wünscht, einen dieser Ringe für Käthchen anfertigen zu können. Seine Gedanken schweifen ständig zu ihr, was ihn dazu bringt, beim Feilen Golddrähtchen zu verschwenden und den Unmut seines Meisters zu erregen. Diese Ablenkung unterstreicht die Macht der Liebe, die den Gesellen von seinen Pflichten entfremdet und ihn in Tagträume entführt.
Die letzte Strophe ist der Höhepunkt der Sehnsucht des Gesellen. Er beobachtet Käthchen beim Stricken, was ihn dazu bringt, von ihrem kleinen Fuß, dem Strumpfhand und letztendlich von einem Kuss zu träumen. Der Wunsch, an ihrer Stelle zu sein, um sie küssen zu können, verdeutlicht seine tiefe Zuneigung und die Unmöglichkeit, seine Gefühle im Moment auszuleben. Das Gedicht endet mit einem bittersüßen Gefühl, da die Liebe des Gesellen zwar stark ist, aber im Moment unerfüllt bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.