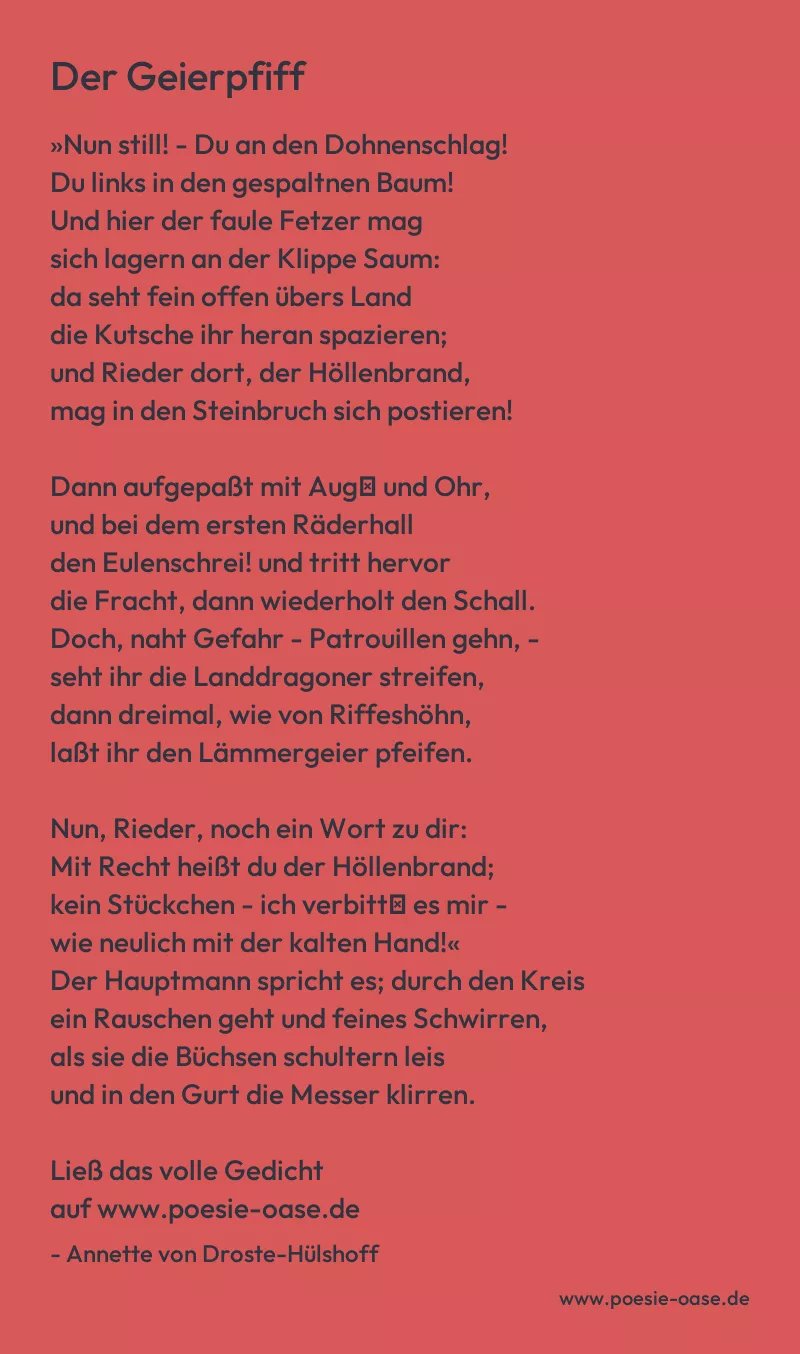»Nun still! – Du an den Dohnenschlag!
Du links in den gespaltnen Baum!
Und hier der faule Fetzer mag
sich lagern an der Klippe Saum:
da seht fein offen übers Land
die Kutsche ihr heran spazieren;
und Rieder dort, der Höllenbrand,
mag in den Steinbruch sich postieren!
Dann aufgepaßt mit Aug′ und Ohr,
und bei dem ersten Räderhall
den Eulenschrei! und tritt hervor
die Fracht, dann wiederholt den Schall.
Doch, naht Gefahr – Patrouillen gehn, –
seht ihr die Landdragoner streifen,
dann dreimal, wie von Riffeshöhn,
laßt ihr den Lämmergeier pfeifen.
Nun, Rieder, noch ein Wort zu dir:
Mit Recht heißt du der Höllenbrand;
kein Stückchen – ich verbitt′ es mir –
wie neulich mit der kalten Hand!«
Der Hauptmann spricht es; durch den Kreis
ein Rauschen geht und feines Schwirren,
als sie die Büchsen schultern leis
und in den Gurt die Messer klirren.
Seltsamer Troß! Hier Riesenbau
und hiebgespaltnes Angesicht,
und dort ein Bübchen wie ′ne Frau,
ein zierliches Spelunkenlicht;
der drüben an dem Scheitelhaar
so sachte streift den blanken Fänger,
schaut aus den blauen Augen gar
wie ein verarmter Minnesänger.
′s ist lichter Tag! die Bande scheut
vor keiner Stunde – alles gleich;
es ist die rote Bande, weit
verschrie′n, gefürchtet in dem Reich;
das Knäbchen kauert unterm Stier
und betet, raschelt es im Walde,
und manches Weib verschließt die Tür,
schreit nur ein Kuckuck an der Halde.
Die Posten haben sich zerstreut,
und in die Hütte schlüpft der Troß –
Wildhüters Obdach zu der Zeit,
als jene Trümmer war ein Schloß;
wie Ritter vor der Ahnengruft
fühlt sich der Räuber stolz gehoben
am Schutte, dran ein gleicher Schuft
vor Jahren einst den Brand geschoben.
Und als der letzte Schritt verhallt,
der letzte Zweig zurückgerauscht,
da wird es einsam in dem Wald,
wo überm Ast die Sonne lauscht;
und als es drinnen noch geklirrt
und noch ein Weilchen sich geschoben,
da still es in der Hütte wird,
vom wilden Weingerank umwoben.
Der scheue Vogel setzt sich kühn
aufs Dach und wiegt sein glänzend Haupt,
und summend durch der Reben Grün
die wilde Biene Honig raubt;
nur leise, wie der Hauch im Tann,
wie Weste durch die Halme streifen,
hört drinnen leise, leise man
vorsichtig an den Messern schleifen. –
Ja, lieblich ist des Berges Maid
in ihrer festen Glieder Pracht,
in ihrer blanken Fröhlichkeit
und ihrer Zöpfe Rabennacht;
siehst du sie brechen durch′s Genist
der Brombeerranken, frisch, gedrungen,
du denkst, die Zentifolie ist
vor Übermut vom Stiel gesprungen.
Nun steht sie still und schaut sich um –
all überall nur Baum an Baum;
ja, irre zieht im Walde um
des Berges Maid und glaubt es kaum;
noch zwei Minuten, wo sie sann,
pulsieren ließ die heißen Glieder –
behende wie ein Marder dann
schlüpft keck sie in den Steinbruch nieder.
Am Eingang steht ein Felsenblock,
wo das Geschiebe überhängt;
der Efeu schüttelt sein Gelock,
zur grünen Laube vorgedrängt,
da unterm Dache lagert sie,
behaglich lehnend an dem Steine,
und denkt: ich sitze wahrlich wie
ein Heil′genbildchen in dem Schreine!
Ihr ist so warm, der Zöpfe Paar
sie löset mit der runden Hand,
und nieder rauscht ihr schwarzes Haar
wie Rabenfittiches Gewand.
Ei, denkt sie, bin ich doch allein!
Auf springt das Spangenpaar am Mieder;
doch unbeweglich gleich dem Stein
steht hinterm Block der wilde Rieder.
Er sieht sie nicht, nur ihren Fuß,
der tändelnd schaukelt wie ein Schiff,
zuweilen treibt des Windes Gruß
auch eine Locke um das Riff;
doch ihres heißen Odems Zug,
Samumes Hauch, glaubt er zu fühlen,
verlorne Laute, wie im Flug
Lockvögel, um das Ohr ihm spielen.
So weich die Luft und badewarm,
berauschend Thymianes Duft,
sie lehnt sich, dehnt sich, ihren Arm,
den vollen, streckt sie aus der Kluft,
schließt dann ihr glänzend Augenpaar –
nicht schlafen, ruhn nur eine Stunde –
so dämmert sie, und die Gefahr
wächst von Sekunde zu Sekunde.
Nun alles still – sie hat gewacht –
doch hinterm Steine wird′s belebt,
und seine Büchse sachte, sacht
der Rieder von der Schulter hebt,
lehnt an die Klippe ihren Lauf,
dann lockert er der Messer Klingen,
hebt nun den Fuß – was hält ihn auf?
Ein Schrei scheint aus der Luft zu dringen!
Ha, das Signal! – er ballt die Faust –
und wiederum des Geiers Pfiff
ihm schrillend in die Ohren saust –
noch zögert knirschend er am Riff –
zum drittenmal – und sein Gewehr
hat er gefaßt – hinan die Klippe!
daß bröckelnd Kies und Sand umher
nachkollern vor dem Steingerippe.
Und auch das Mädchen fährt empor:
»Ei, ist so locker das Gestein?«
Und langsam, gähnend tritt hervor
sie aus dem falschen Heil′genschrein,
hebt ihrer Augen feuchtes Glühn,
will nach dem Sonnenstande schauen,
da sieht sie einen Geier ziehn
mit einem Lamm in seinen Klauen.
Und schnell gefaßt, der Wildnis Kind,
tritt sie entgegen seinem Flug:
der kam daher, wo Menschen sind,
das ist der Bergesmaid genug.
Doch still! war das nicht Stimmenton
und Räderknarren? Still! sie lauscht –
und wirklich, durch die Nadeln schon
die schwere Kutsche ächzt und rauscht.
»He, Mädchen!« ruft es aus dem Schlag,
mit feinem Knix tritt sie heran,
»zeig uns zum Dorf die Wege nach,
wir fuhren irre in dem Tann!« –
»Herr,« spricht sie lachend, »nehmt mich auf,
auch ich bin irr′ und führ′ euch doch.« –
»Nun wohl, du schmuckes Kind, steig auf,
nur frisch hinauf, du zögerst noch?«
»Herr, was ich weiß, ist nur gering,
doch führt es euch zu Menschen hin,
und das ist schon ein köstlich Ding
im Wald, mit Räuberhorden drin;
seht, einen Weih am Bergeskamm
sah steigen ich aus jenen Gründen,
der in den Fängen trug ein Lamm;
dort muß sich eine Herde finden.« –
Am Abend steht des Forstes Held
und flucht die Steine warm und kalt;
der Wechsler freut sich, daß sein Geld
er klug gesteuert durch den Wald,
und nur die gute, franke Maid
nicht ahnet in der Träume Walten,
daß über sie so gnädig heut
der Himmel seinen Schild gehalten.