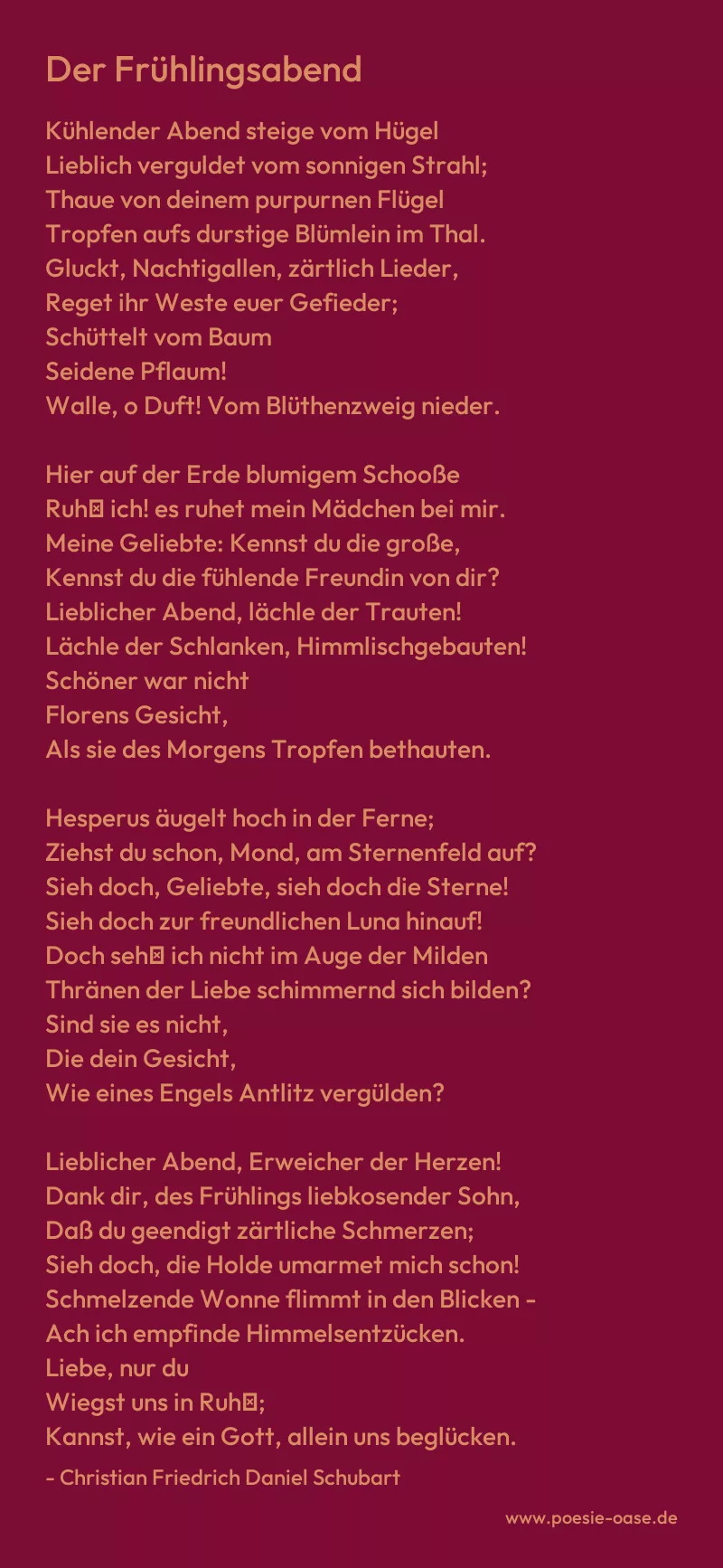Kühlender Abend steige vom Hügel
Lieblich verguldet vom sonnigen Strahl;
Thaue von deinem purpurnen Flügel
Tropfen aufs durstige Blümlein im Thal.
Gluckt, Nachtigallen, zärtlich Lieder,
Reget ihr Weste euer Gefieder;
Schüttelt vom Baum
Seidene Pflaum!
Walle, o Duft! Vom Blüthenzweig nieder.
Hier auf der Erde blumigem Schooße
Ruh′ ich! es ruhet mein Mädchen bei mir.
Meine Geliebte: Kennst du die große,
Kennst du die fühlende Freundin von dir?
Lieblicher Abend, lächle der Trauten!
Lächle der Schlanken, Himmlischgebauten!
Schöner war nicht
Florens Gesicht,
Als sie des Morgens Tropfen bethauten.
Hesperus äugelt hoch in der Ferne;
Ziehst du schon, Mond, am Sternenfeld auf?
Sieh doch, Geliebte, sieh doch die Sterne!
Sieh doch zur freundlichen Luna hinauf!
Doch seh′ ich nicht im Auge der Milden
Thränen der Liebe schimmernd sich bilden?
Sind sie es nicht,
Die dein Gesicht,
Wie eines Engels Antlitz vergülden?
Lieblicher Abend, Erweicher der Herzen!
Dank dir, des Frühlings liebkosender Sohn,
Daß du geendigt zärtliche Schmerzen;
Sieh doch, die Holde umarmet mich schon!
Schmelzende Wonne flimmt in den Blicken –
Ach ich empfinde Himmelsentzücken.
Liebe, nur du
Wiegst uns in Ruh′;
Kannst, wie ein Gott, allein uns beglücken.