Kleiner goldner Schmetterling,Ach, du kamst so früh heraus,Und nun irrst du armes DingIn die leere Welt hinaus.Keine Blume kam hervor,Und kein Glöckchen lässt sich sehn −Schmetterling, du armer Tor,Du musst untergehn.Und ich schaute unverwandt,Wie er schwankte, suchend irr,Bis sein goldner Schimmer schwandIn dem öden Zweiggewirr.
Der frühe Schmetterling
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
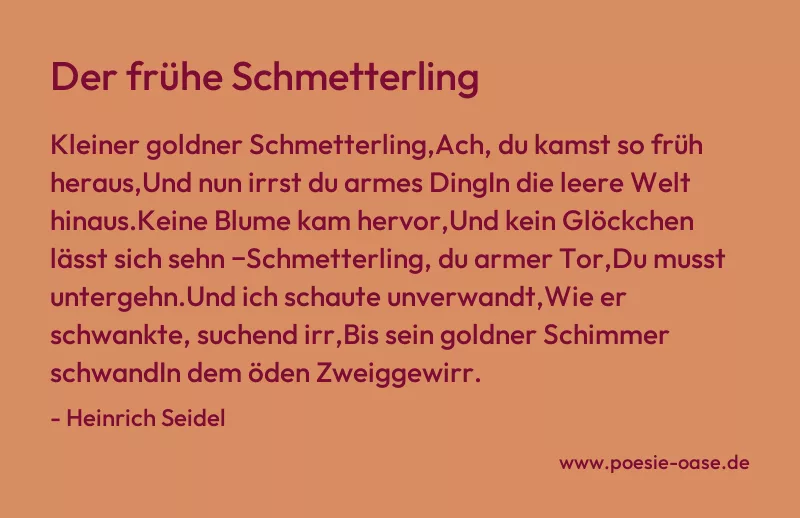
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der frühe Schmetterling“ von Heinrich Seidel beschreibt in melancholischer Weise das Schicksal eines Schmetterlings, der zu früh aus seinem Kokon schlüpft und in einer noch kalten und blütenlosen Welt verloren ist. Die Einfachheit der Sprache und die gewählten Bilder erzeugen eine eindringliche Atmosphäre der Einsamkeit und des Untergangs. Das Gedicht thematisiert die Vergänglichkeit und die Unbarmherzigkeit der Natur, sowie die Verletzlichkeit des Einzelnen, der den Widrigkeiten der Welt ausgesetzt ist.
Der Dichter beginnt mit einer direkten Ansprache an den Schmetterling, was eine Verbindung zwischen dem Beobachter und dem beobachteten Objekt herstellt. Die Adjektive „klein“ und „gold“ erzeugen zunächst ein Gefühl von Zartheit und Schönheit, doch der Satz „Ach, du kamst so früh heraus“ deutet bereits die Tragik des Geschehens an. Der Schmetterling wird als „armes Ding“ bezeichnet, was Empathie für sein Schicksal weckt. Die Welt wird als „leere Welt“ beschrieben, in der keine Blumen blühen und keine Glocken läuten, was die Isolation des Schmetterlings betont und die Aussichtslosigkeit seines Daseins hervorhebt.
Die zweite Strophe verstärkt die Tragik. Der Schmetterling wird als „armer Tor“ bezeichnet, was seine Unwissenheit und sein Scheitern unterstreicht. Die Wiederholung des Ausdrucks „Du musst untergehn“ am Ende des zweiten und dritten Verses ist wie ein unerbittliches Urteil, das auf sein unausweichliches Schicksal verweist. Die Verwendung von Reim und Rhythmus verstärkt die Melancholie und den Sog des Untergangs. Das Fehlen jeglicher Hoffnung auf eine freundlichere Umgebung für das Insekt verstärkt das Gefühl der Verzweiflung und des Verlustes.
In der letzten Strophe beschreibt der Dichter seine Beobachtung des Schmetterlings, wie er „schwankte, suchend irr“ und schließlich im „öden Zweiggewirr“ verschwindet. Das Verschwinden des „goldnen Schimmers“ symbolisiert das Ende des Schmetterlings und den Verlust seiner Schönheit und seines Lebens. Der Dichter schaut „unverwandt“, was seine Anteilnahme und die Intensität seines Blicks verdeutlicht. Das „öde Zweiggewirr“ steht für die trostlose und unbarmherzige Natur, die den Schmetterling verschluckt und sein kurzes Dasein beendet. Das Gedicht lässt somit eine tiefe Trauer über die Kürze und Fragilität des Lebens erahnen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
