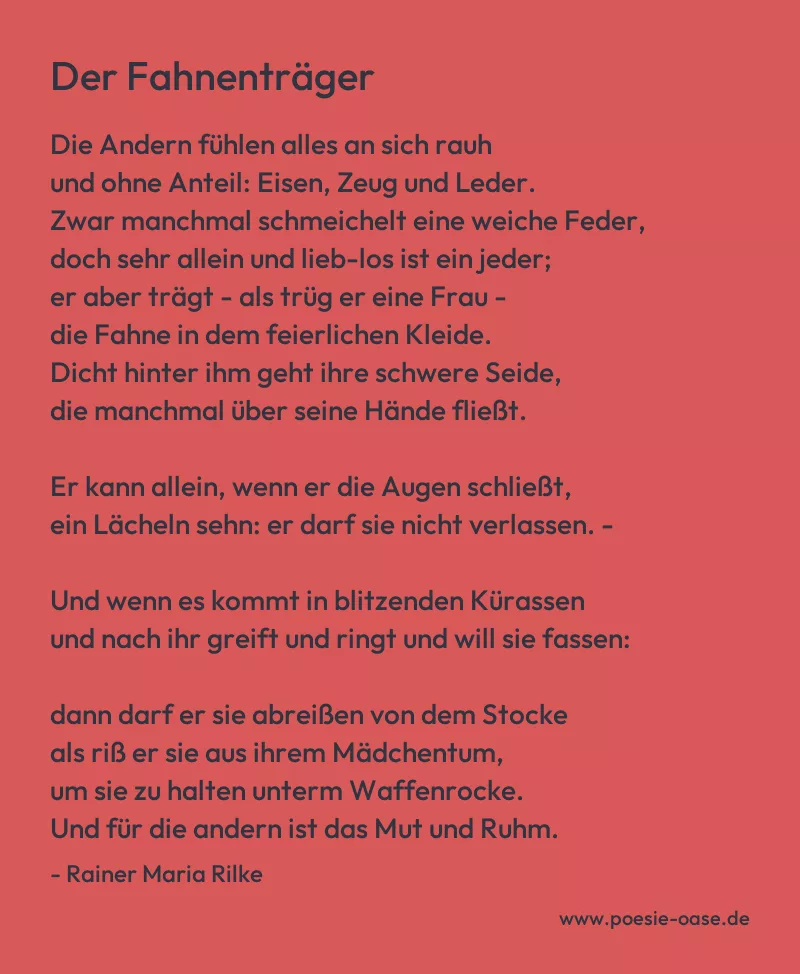Der Fahnenträger
Die Andern fühlen alles an sich rauh
und ohne Anteil: Eisen, Zeug und Leder.
Zwar manchmal schmeichelt eine weiche Feder,
doch sehr allein und lieb-los ist ein jeder;
er aber trägt – als trüg er eine Frau –
die Fahne in dem feierlichen Kleide.
Dicht hinter ihm geht ihre schwere Seide,
die manchmal über seine Hände fließt.
Er kann allein, wenn er die Augen schließt,
ein Lächeln sehn: er darf sie nicht verlassen. –
Und wenn es kommt in blitzenden Kürassen
und nach ihr greift und ringt und will sie fassen:
dann darf er sie abreißen von dem Stocke
als riß er sie aus ihrem Mädchentum,
um sie zu halten unterm Waffenrocke.
Und für die andern ist das Mut und Ruhm.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
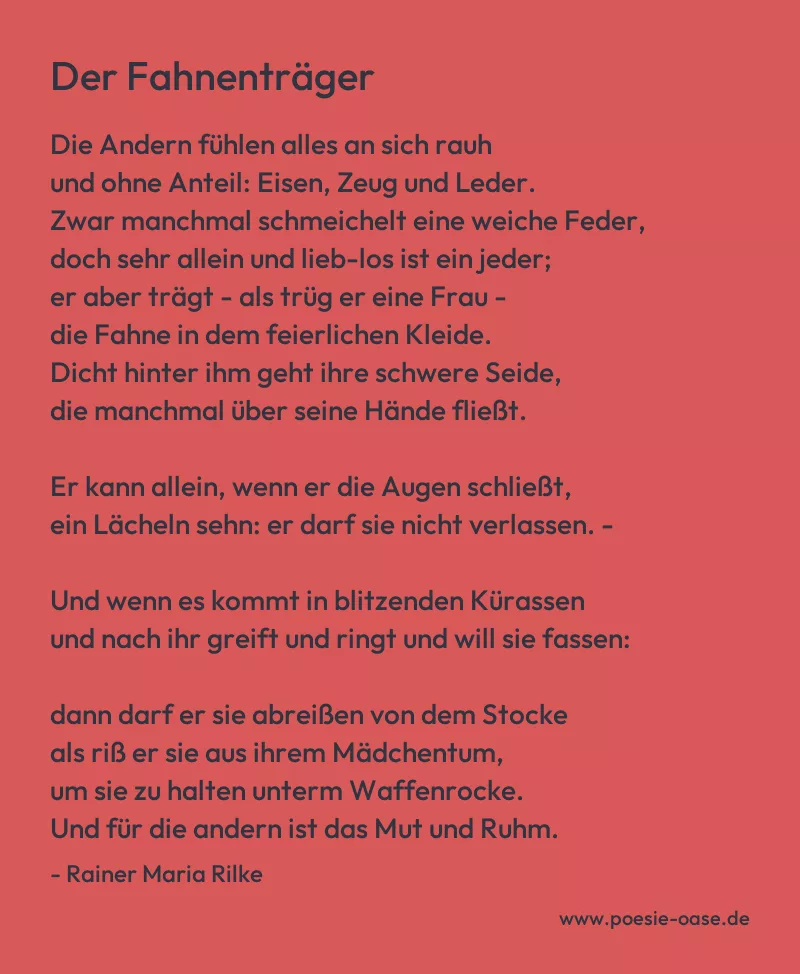
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Fahnenträger“ von Rainer Maria Rilke zeichnet ein komplexes Bild des Soldaten, der seine Fahne nicht nur als militärisches Objekt, sondern als etwas Persönliches, fast Intimes betrachtet. Die Eröffnung zeigt die Distanz der anderen Soldaten zu ihren Ausrüstungsgegenständen. Diese empfinden das „Eisen, Zeug und Leder“ als roh und unbeteiligt, während selbst die gelegentliche „weiche Feder“ keine wirkliche Geborgenheit bietet. Der Fahnenträger hingegen hat eine tiefere Beziehung zu seiner Fahne, die er behandelt, „als trüg er eine Frau“. Diese Metapher setzt den Ton für die gesamte Interpretation und deutet auf eine tiefe emotionale Bindung und Verehrung hin.
Die zweite Strophe vertieft diese Beziehung. Die Fahne wird als „schwere Seide“ beschrieben, die „manchmal über seine Hände fließt“. Dieser sinnliche Ausdruck suggeriert eine Intimität und Zärtlichkeit, die über die bloße Pflicht hinausgeht. Der Fahnenträger kann, wenn er die Augen schließt, ein Lächeln erblicken, was auf eine Verbindung zu einer inneren Welt hindeutet. Die Zeile „er darf sie nicht verlassen“ unterstreicht die absolute Loyalität, die er der Fahne, seinem Objekt der Verehrung, schuldet. Diese Verpflichtung ist nicht nur militärisch, sondern auch emotional.
Der dritte Teil des Gedichts stellt eine dramatische Wendung dar. Die Fahne wird hier als Objekt der Begierde dargestellt, als etwas, wonach „es“ (vermutlich ein feindlicher Angriff) greift und ringt. Der Fahnenträger hat die Aufgabe, sie zu beschützen, sie vor dem Zugriff des Feindes zu bewahren. Die Zeile „dann darf er sie abreißen von dem Stocke / als riß er sie aus ihrem Mädchentum“ erzeugt einen starken Kontrast zwischen der Verehrung und der Notwendigkeit, die Fahne zu verteidigen. Dieser Akt des „Abreißens“ könnte als Gewaltakt interpretiert werden, der symbolisch die Unschuld und Verletzlichkeit der Fahne (und möglicherweise auch des Fahnenträgers) verdeutlicht.
Abschließend wird die Frage nach dem, was die anderen sehen, in den Vordergrund gerückt: „Und für die andern ist das Mut und Ruhm.“ Während der Fahnenträger seine tiefe persönliche Verbindung zur Fahne hat, sehen die anderen Soldaten lediglich Mut und Ruhm. Rilke hebt somit die Dichotomie zwischen persönlicher Erfahrung und der kollektiven Wahrnehmung hervor. Das Gedicht hinterfragt, ob die Hingabe des Fahnenträgers als reine Pflichterfüllung oder als etwas tiefere, intime Verbindung zu verstehen ist. Das Gedicht lädt somit dazu ein, über die wahre Natur des Krieges, des Opfers und der Liebe nachzudenken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.