Narr, du prahlst, ich befriedge dich nicht! Am Mindervoll-kommnen
Sich erfreuen, zeigt Geist, nicht am Vortrefflichen, an!
Der Bewunderer des Shakespeare
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
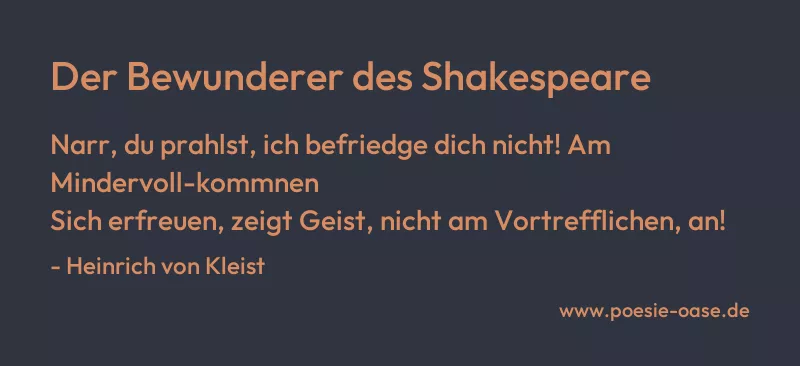
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Bewunderer des Shakespeare“ von Heinrich von Kleist ist eine kurze, pointierte Kritik an einem fälschlicherweise verstandenen Ideal der Bewunderung und des künstlerischen Genusses. Es beginnt mit einer direkten, fast trotzigen Anrede, in der das lyrische Ich den Angesprochenen – den „Narr“ – zurückweist und ihm seine Bewunderung abspricht. Dieser schroffe Einstieg signalisiert bereits eine klare Distanzierung und die Absicht, die vermeintliche Überlegenheit des Angesprochenen zu entlarven.
Die Kritik richtet sich nicht gegen die Bewunderung an sich, sondern gegen die Art und Weise, wie der Angesprochene seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Kleist deutet an, dass wahre geistige Größe und wahre Freude sich nicht in der Anerkennung des „Mindervoll-kommnen“ finden, sondern im Verständnis und der Wertschätzung des „Vortrefflichen“. Das Gedicht argumentiert somit für eine tiefere, fundiertere Auseinandersetzung mit Kunst und einer kritischen Selbstreflexion, um das Niveau der eigenen Wertschätzung zu erhöhen.
Der Gebrauch von Gegensätzen wie „Mindervoll-kommen“ und „Vortrefflich“ unterstreicht die zentrale Botschaft des Gedichts. Kleist macht deutlich, dass die Freude an dem scheinbar Leichten und Unvollkommenen nicht als Zeichen von Geist, sondern als Ausdruck von mangelndem Anspruch zu werten ist. Die bewusste Wahl dieser Worte erzeugt eine Spannung, die den Leser dazu anregt, über die eigene Art der Kunstbetrachtung und -bewertung nachzudenken. Es ist eine Aufforderung, sich der eigenen Unzulänglichkeiten bewusst zu werden und sich nach Höherem zu streben.
Die Kürze des Gedichts, die nur aus zwei Versen besteht, verstärkt seine Wirkung. Durch die prägnante Formulierung und die pointierte Rhetorik entfaltet das Gedicht seine ganze Kraft. Kleist erreicht mit wenigen Worten eine tiefe Aussage, die sowohl den Angesprochenen als auch den Leser herausfordert, die eigene Haltung gegenüber Kunst und Genuss zu hinterfragen. Es ist ein Manifest für eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit Kunst und die Suche nach wahrem, tiefem Verständnis.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
