Ach, wie erwähltet Ihr heut, Herr Pfarr, so erbauliche Lieder!
Grade die Nummern, seht her, die ich ins Lotto gesetzt.
Der Bauer, als er aus der Kirche kam
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
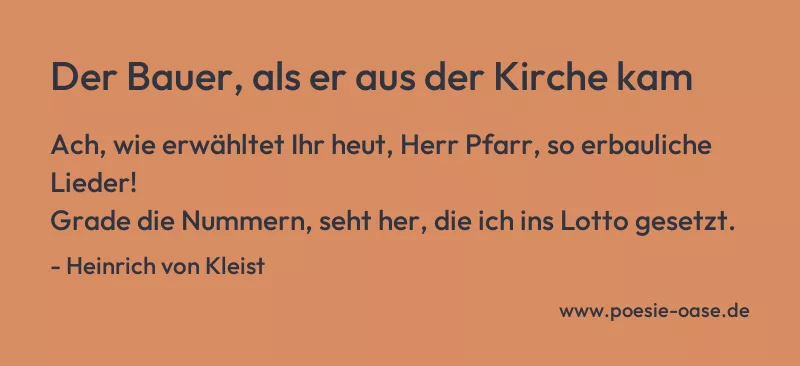
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Bauer, als er aus der Kirche kam“ von Heinrich von Kleist ist ein kurzer, humorvoller Vers, der auf subtile Weise Kritik an der Kirche und an der mangelnden Religiosität der dargestellten Figur übt. Es offenbart eine Diskrepanz zwischen dem, was in der Kirche eigentlich vermittelt werden sollte, und dem, worauf die Gedanken des Bauern nach dem Gottesdienst fixiert sind.
Der erste Vers drückt scheinbar Anerkennung für die Predigt des Pfarrers aus, indem er dessen Lieder als „erbaulich“ bezeichnet. Allerdings wird diese Wertschätzung sogleich durch die zweite Zeile untergraben, in der die zentrale Aussage des Gedichts formuliert wird: Der Bauer interessiert sich nicht für die religiösen Inhalte der Predigt, sondern vielmehr dafür, welche der Lieder er im Lotto getippt hat. Die Betonung des Wortes „Grade“ deutet darauf hin, dass die ausgewählten Lieder genau die Nummern waren, die er für das Lotto gesetzt hatte, wodurch die religiöse Erbauung in den Hintergrund gerückt wird.
Die Ironie des Gedichts liegt in dieser deutlichen Verlagerung des Interesses. Der Bauer scheint die Kirche primär zu besuchen, um seinen Lotto-Schein zu überprüfen, und nicht, um spirituelle Nahrung zu finden. Dies wirft ein satirisches Licht auf die Oberflächlichkeit und den materialistischen Fokus der Figur. Kleist nutzt hier das Stilmittel der Pointe, um mit wenigen Worten eine ganze Geschichte von Ablenkung und fehlender Ernsthaftigkeit zu erzählen.
Das Gedicht ist ein Beispiel für Kleists meisterhafte Fähigkeit, mit sparsamen Mitteln eine komplexe menschliche Situation darzustellen. Die Kürze des Gedichts und die einfache Sprache verstärken die Wirkung und machen die Kritik umso eindringlicher. Es ist ein subtiles, aber wirkungsvolles Statement über die Kluft zwischen dem Schein und dem Sein, zwischen dem, was erwartet wird, und dem, was tatsächlich geschieht, und wirft Fragen nach der Motivation der Kirchenbesucher auf.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
