Ein Quidam sagt: „Ich bin von keiner Schule!
Kein Meister lebt, mit dem ich buhle;
Auch bin ich weit davon entfernt,
Dass ich von Toten was gelernt.“
Das heißt, wenn ich ihn recht verstand:
„Ich bin ein Narr auf eigne Hand.“
Den Originalen
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
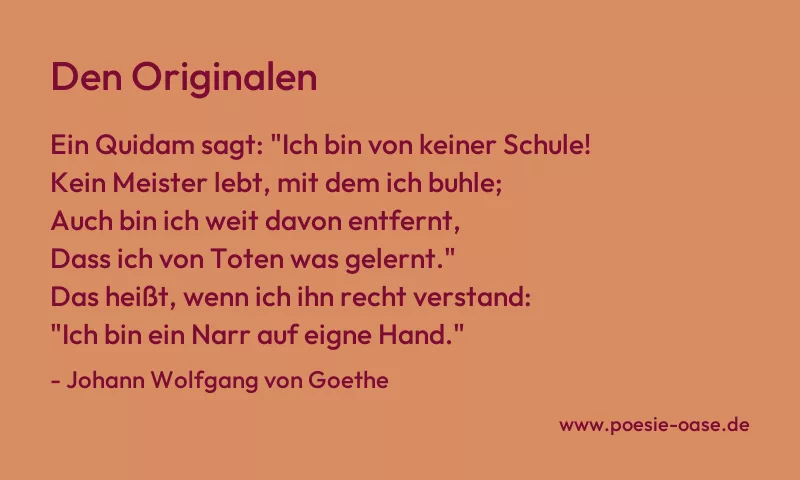
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Den Originalen“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine pointierte Satire auf den Hochmut und die vermeintliche Eigenständigkeit eines Menschen, der sich von jeglicher Tradition und Vorbildung distanziert. Die wenigen Verse konzentrieren sich auf die Aussage eines „Quidam“, einer anonymen Person, die sich selbst als ungebunden und unabhängig darstellt.
Der „Quidam“ behauptet, er stamme von „keiner Schule“ und stehe in keinem Wettbewerb mit Meistern. Er habe auch von den Toten, also von der reichen Tradition der Literatur und des Wissens, nichts gelernt. Diese dreifache Negation dient als Grundlage für die eigentliche Botschaft des Gedichts: Indem der „Quidam“ sich von allem abgrenzt, was ihn formen und bilden könnte, offenbart er in Goethes Augen letztlich seine eigene Torheit.
Goethe nutzt eine einfache, aber wirkungsvolle Sprache, um seine Kritik zu äußern. Der direkte Dialog – „Ein Quidam sagt“ – erweckt den Eindruck einer Unterhaltung, die den Leser unmittelbar anspricht. Die Wiederholung von „ich“ betont die Selbstbezogenheit des „Quidam“, während die Reime – Schule/buhle, entfernt/gelernt, verstand/Hand – die Aussage verdichten und einprägsam machen.
Die Pointe des Gedichts ist der letzte Vers: „Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: / ‚Ich bin ein Narr auf eigne Hand.‘“ Hier nimmt Goethe dem „Quidam“ seine vermeintliche Originalität und kehrt sie ins Gegenteil. Die scheinbare Eigenständigkeit wird als Ausdruck von Unwissenheit und Selbstüberschätzung entlarvt. Der „Narr“ ist nicht originell, sondern lediglich unfähig, von den Erfahrungen und dem Wissen anderer zu profitieren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
